|
Zwischen Bild und Realität fällt machtvoll der Schatten,
und der Schatten ist für manchen gewiss manches,
er ist für mich Literatur.[1]
I.
Ende September. Ein Dorf in der Eifel. Wälder ringsum. Eine alte
Stadtmauer. Ein kleiner Marktplatz. Noch einmal flutet die Sonne Häuser und
Straßen. Es duftet nach Brezeln und Frischgebackenem. Nach Kaffee und
Morgenzeitungen. Laub und Kastanien bedecken das Pflaster.
Ich mische mich
unter die Passanten, gehe mit ihnen die Bürgersteige entlang; ich komme an
vertrauten Orten vorbei, ich sehe bekannte Gesichter oder erblicke mich flüchtig
in den Schaufenstern und in den Spiegeln, die sie hier und da umrahmen. So
erscheint im Gehen für ein oder zwei Sekunden der Kopf, die Brust, der ganze
Körper…[2]
Der Wind wirbelt Blätter auf und spielt ein Lied, das mir bekannt
vorkommt. Irgendwo schon mal gehört. Doch kann ich nicht sagen, wo und wann.
Dann ist es lange Zeit still. Ich bin in die Eifel gefahren, um mit dem
Schriftsteller Christian Linder über seine Essaysammlung Noten an den Rand
des Lebens[3]
und sein Buch Sommermusik[4]
zu sprechen. Sommermusik ist die faszinierende Geschichte über den Sommer
des Jahres 1841, als Franz Liszt mit Marie d´Agoult mehrere Monate auf der
südlich von Bonn, gegenüber von Rolandseck gelegenen Rheininsel Nonnenwerth
verbringt und das kurze, melancholische Musikstück „Die Zelle in Nonnenwerth“
schreibt: An diesem Morgen am Rhein spürte er die Stille in sich sehr
deutlich, aber sie sprach — zum ersten Mal wieder seit langer Zeit — von der
Angst, die eigene Unwissenheit nicht zugeben und deshalb seine Leere nicht zum
Sprechen und Klingen bringen zu können — weil vielleicht die Radikalität… nicht
ausreichte, um einen neuen Blick aufs Leben und seine abgründigen Geheimnisse in
seiner Musik ausdrücken zu können.[5]
Angst, das Geheimnis des Lebens, seines Lebens, nicht in eine Melodie
übersetzen zu können. Angst, die Kunst sei Zeuge der eigenen Unvollkommenheit.
Angst, nicht weit genug in sich selbst eindringen, in den eigenen, schweren
Körper hineinblicken zu können, in die Schmerzen, das Leid, die Lust. Angst, die
in der Sommermusik in einem von Liszt und Marie d’Agoult gemeinsam
verfassten und sich durch das Buch ziehenden Gedicht benannt wird: dort,
sagt Liszt, ist der Rhein und / die Insel Nonnenwerth und ich erkläre / dir
mein Verständnis für die / Angst auf sich selbst zu schauen / Angst vielleicht
nichts sehen zu können / Angst die beschwichtigt wird beim Aufzählen / der Dinge
in der Landschaft / dort sind die Bäume die Wiesen / die Alleen das alte Haus
der Himmel der/ Wind der Regen und der Schnee und dort ist die / Nacht und dort
auch gleich nah / die schönen alten Hotels an der belgischen Küste / »Ich würde
auch gern wieder mal am Wochenende / wegfahren« hörte ich dich sagen ich
erinnere / mich als wir uns noch nicht kannten und / dies sage ich jetzt / dies
ist Erinnerung und Gegenwart zugleich / auch dieser Sommer Sonntag Nachmittag /
geht vorbei und / die Arbeit bleibt dieselbe / die Dispositionen die Bücher die
Musik die Arbeit / die Dispositionen eines Lebens zu erklären / wieder und
wieder/ was macht die Liebe? / es ist still / die Bäume stehen herum / hier ist
niemand / nur noch einige Gespenster / die auf ihren Auftritt warten« /»Eine
Wohnung so als eine Art Hochsitz«, sagte Marie d’Agoult, / »aber ich liebe sage
ich zugleich / ich liebe doch deine Veränderungen und / die Schwächen meiner
Noten / jetzt und ich möchte mich erinnern an unsere / Spaziergänge im Winter im
Schnee was / werde ich sagen? / die warme Wohnung die Musik in allen Räumen /
die Projektionen was werde ich sagen?« / »Deine wunderbaren Fluchtburgen«, sagte
Marie d’Agoult, / »aber ich weiß«, antwortete Liszt sofort, / »hier ist niemand
/ es ist still / die Bäume stehen herum / zu sagen gab es heute nichts / zu
lesen nur den Satz eines Dichters / der sich selbst zitierte / in der
Vergangenheit: / »Hörte ich mich von der Liebe sagen: / sie allein bringt die
Erleichterung / den Atem und den Schlaf« / so dass ich aufstand und mir die
Jacke anzog / vor den Spiegel trat und / sagte: / was willst du?«
Angst vor dem Schweigen des Ichs, vor dem Echo, das aus der Tiefe des eigenen
Lebens hallt.
Von Nähe und Ferne, die nicht immer zu unterscheiden sind, von Anfang
und Ende und von der Angst, etwas zu Ende bringen zu müssen und es nicht zu Ende
bringen zu können, erzählt sein Stück »Die Zelle von Nonnenwerth« auch.
Das Nahe und das Ferne. Sie wechseln unaufhörlich die Positionen auf
der Kreisbahn des Lebens. Ich schlage das Buch zu und gehe ein Stück in Richtung
der alten Burganlage. In einem geheimnisvollen Garten begegne ich einem einsamen
Schatten. Für einen Augenblick ist es als richte er sein Wort an mich, als
spräche er zu mir, über sich:
Schau dir die Schatten an… Beschreib
die Schatten… Das Beste wäre natürlich, wenn deine schwarzen Sätze auf dem
weißen Papier die Schatten nicht nur beschreiben, sondern die Schatten selber
sind. Unbegreiflich und unerklärbar.
Wortschatten, meine Sätze ein Teil davon; Schatten welcher Sprache, von
wem gesprochen? Wo ist der Körper, in dessen langer Tollheit alle Worte auf
ungeklärte Weise zusammenhängen? Wie muss der Körper eines Schriftstellers
beschaffen sein, um diese eine unvergessene Melodie aus Sätzen zu spielen, diese
ureigenen literarischen Noten, die das Gedächtnis niemals kennen wird?
II.
In seinen „Noten an den Rand des Lebens“ schrieb Novalis einst, das größte
Geheimnis sei der Mensch sich selbst; Literatur sei der Versuch, dieses
Geheimnis zu lüften. Aber lässt sich das Geheimnis jemals ganz lüften? Bleibt
nicht immer ein Rest, der nicht aufgeht? Ein blinder Fleck in jedem Wort? Welche
Literatur taugt schon zur Anthropologie? Welchem Wesen wollte sie denn auf den
Grund gehen?
Ich suche den Schriftsteller Christian Linder, weil ich mir eine Antwort erhoffe
— erscheint Literatur in seinen Noten an den Rand des Lebens, in seinen
Kryptogrammen doch als Verschleierung, wenn nicht gar als Multiplikation
menschlicher Mysterien. Der Mensch ist das Wesen, das spricht, und durch den Akt
des Sprechens Nebelkerzen auf die eigene Identität losschießt.
Während ich in dem großen Garten des kleinen Eifeldorfes umher wandere,
schlage ich Linders Buch auf, das den Titel des Novalis-Zitats trägt. Der
Untertitel: Portraits und Perspektiven. Es handelt sich um Texte aus den
vergangenen vierzig Jahren — teils älter als ich; Miniaturen der deutschen und
europäischen Literatur seit den frühen 1970er Jahren. In einem kurzen Text aus
dem Jahre 1979 über seinen Freund, den Kölner Dichter Jürgen Becker, bemerkt
Linder gleich zu Beginn: Was in den Büchern steht, ist nicht wichtig;
sondern, was nicht darin steht — und warum nicht.
Es soll nicht wichtig sein, was in den Büchern steht? — Das ist ein
unerhörter, verstörender Satz, und er wirft einen mörderischen Schatten auf die
Geschichte der Literatur, auf das Dunkle der Texte, die es zu beleuchten gilt.
Denn da steht ja das alles entscheidende Warum nicht? Wer könnte das
schon beantworten? Und selbst, wenn es eine Antwort gäbe, blendet sie doch
wieder anderes aus. Jede Antwort vernarbt nur die Fragen, die ihr vorausgehen.
Ist also nicht letztlich das, was nicht in den Büchern steht, selber der
Schleier, der über die Literatur geworfen wird, um sie zu »entlarven«?
Dieses Interesse an dem, was nicht in den Büchern steht, denke ich, nachdem die
erste Erregung in meinem Körper wieder abgeklungen ist — lässt es sich nicht
zurückverfolgen in der Geschichte der Dichtungen und Dramen, der Prosastücke und
Poesien? Ich denke insbesondere an Hugo von Hofmannsthals lyrisches Drama „Der
Tor und der Tod“. Darin charakterisiert der Tod am Ende die Haltung der
Menschen:
„Wie
wundervoll sind diese Wesen,
Die, was nicht deutbar, dennoch
deuten,
Was nie geschrieben wurde, lesen,
Verworrenes beherrschend binden
Und Wege noch im Ewig-Dunkeln finden.“[6]
Was nie geschrieben wurde, lesen. Das unterstellt der Tod den Menschen
und findet sie „wundervoll“. Man kann die Zeile als Aufforderung interpretieren.
Aber ist es wirklich so einfach, wie der Tod glaubt, Verworrenes
zusammenzubinden und Wege im Ewig-Dunklen zu finden? Zwar lässt sich Christian
Linders Arbeit mit den Worten des Todes vielleicht am besten charakterisieren.
Gleichwohl frage ich mich: Was steht bei ihm selbst nicht geschrieben? Welches
Geheimnis hütet der Schriftsteller Linder in seinen Büchern? Das möchte
ich wissen, und vor allem deshalb bin ich auf der Suche nach ihm. Aus diesem
Grunde bin ich in die Eifel gefahren, um mir ein Bild zu machen von dem, der
wissen will, was in den Büchern verheimlicht wird.
Noch während ich in dem kleinen Ort darüber nachdenke, öffnen sich
die Straßen zu anderen Straßen, zu baumbeschatteten Plätzen mit rieselnden
Brunnen… Häuserzeilen, Wohnungen mit offenen Fenstertüren, wo man mich ruft… die
Straße mit den verfallenen Häusern, mit den von blühenden Glyzinien und
Kletterpflanzen bewachsenen Fassaden; Häuser, deren Salons mit bunten Fenstern
hier und da über die Gärten blicken… Genau hier. Doch die Zeit ist da, wo der
Schatten immer dichter und kühler werden will…[7]
III.
Der Schatten, der die ganze Zeit über hastig rauchend neben mir her gegangen
ist, hält plötzlich inne und kommentiert mein Hofmannsthalzitat: Das
Nie-Geschriebene lesen – eine elegante Formulierung, aber vielleicht auch ein
bisschen zu preziös.
— „Wieso preziös?“, möchte ich wissen.
— Nun, trotz aller Verstellungs- und
Verschleierungsversuche eines Autors – wenn er sich zum Beispiel einer
gefährlichen Wahrheit nähert – verrät sich jeder Schriftsteller am Ende doch
immer.
— „Inwiefern verrät er sich immer?“ hake ich nach.
— Man muss nur hinter den
offiziellen Text schauen, die dunklen
Schichten aufdecken, die unter dem liegen, was wir sagen, die Schattenbereiche
zwischen den Wörtern.
Es ist, wie Roland Barthes gesagt hat, der Körper, der die Bücher
schreibt. Und die Erinnerungen des Körpers geben dem Nicht-Geschriebenen hinter
dem offiziellen Text die Gewalt; auch das Verzerrte und Monströse.
— „Ich verstehe“, sage ich zu dem Schatten. „Man muss den Körper des
Schriftstellers lesen.“
— „Möglich“ antwortet der Schatten hustend.
In der Sommermusik lässt Christian Linder seinen Protagonisten Franz
Liszt in Anlehnung an einen französischen Romancier des 20. Jahrhunderts sagen:
Mein Körper hat andere Erinnerungen als mein Gedächtnis, Marie. Aber die
Erinnerungen meines Körpers kenne ich nicht. Das Glücksgefühl beim Sterben wird
dann jedoch hoffentlich sein, dass der Körper alle Erinnerungen freigibt und man
im Schlussbild noch einmal sehen kann, was denn nun wirklich passiert ist.
Am Ende des Lebens ist alles zitierfähig geworden, alles liegt offen zutage.
Doch es ist nicht etwa der Messias, der durch die Pforte kommt, die letzte
Wahrheit verkündet und die Geschichte an ihr Ende führt, wie die Religion es
will, sondern der menschliche Körper, der verletzbare, gebrechliche, leidende,
lustvolle, angstbesetzte, taumelnde Körper, der uns sagt, wie es eigentlich
gewesen. Die Literatur siegt über den Glauben.
„Es fällt natürlich auf“, sage ich zu dem mich begleitenden Schatten,
„dass in all den Büchern von ihm der Körper eine, wenn nicht die zentrale Rolle
spielt. Auch in dem Gespräch zwischen ihm und Claude Simon in den Noten
heißt es, es sei natürlich immer der Körper, der die Bücher schreibt.
Diese Idee zieht sich als roter Faden durch alle Schriften, vom Carl
Schmitt-Buch[8]
über die Böll-Biografie[9]
bis hin zur Sommermusik, die den Körper zum Instrument der Sprache macht
und mit Zitaten spielt als wären Worte Tasten eines Klaviers. Das Buch über den
Kölner Literaturnobelpreisträger Böll hingegen trägt den Titel Das Schwirren
des heranfliegenden Pfeils — nach dem Jean Paulschen Hinweis, dass »das
Schicksal den Pfeil des Todes aus der Ewigkeit abschickt«, sobald jemand zu
leben beginnt, die Flugbahn des Pfeils beschreibt und die Frage aufwirft, ob
Böll irgendwann in seinem Leben die Möglichkeit gehabt hat, das Schwirren des
heranfliegenden Pfeils zu hören und daraufhin meinte, eine Kurskorrektur
vornehmen zu müssen. Die Frage stellt sich natürlich für uns alle: Wann ist uns
gewiss, dass uns der Pfeil treffen wird? Und wie bringen wir das zur Sprache?
Wie kommen wir überhaupt zur Sprache? Nicht jeder, der leidet, ist ein guter
Schriftsteller, mitunter mag das Schreiben das Leiden gar verdoppeln...
Ich denke auch an das Carl Schmitt-Buch, in dem Schmitts monströses politisches
Theorie-Gebäude als reine Literatur gelesen und entziffert, die
politisch-dramatische Inszenierung der Sätze, sein magischer Begriffsrealismus
dechiffriert wird. Schmitts Gedanken funktionieren nur als Bild, und diese
Bilder nutzt er, um die Langeweile und Kraftlosigkeit seiner Existenz zu
überblenden, den Staat als Kunstwerk in seinen Schriften zu inszenieren.
Wie hängt das alles zusammen? Böll, der unentwegt gegen die Wirren der
Zeit seine Kindheit verteidigt; Schmitt, der auf lebenslanger Fahrt ins
Unbekannte des Staates, ins abgelegene Gehöft der Politik vorstößt, wo die
Spinnen die großen Namen der Welt weben; Liszts Körpergedächtnis, das eine
melancholische Sommermusik ersinnt — so unterschiedlich die Themen sein mögen,
Linder liest in den Eingeweiden seiner „Helden“. Der Körper des Schriftstellers,
sein eigener, versucht stets, mit jeder Silbe und jedem Jota eine Einheit zu
stiften, wo es im Grunde keine Einheit geben kann; er versucht, alles, was einem
bislang vertraut erschien, in einem neuen Licht aufleuchten zu lassen. Alles
Neue beginnt zweifellos als Abweichung und wird begleitet von Verunsicherung,
begleitet von der Ahnung, welch unüberschaubares System nicht nur die Sprache
ist, die wir sprechen, es wird ebenso begleitet von der Furcht vor einer immer
komplexer werdenden Welt. In dem Moment, in dem drei Finger schreiben und der
ganze Leib leidet, in dem Augenblick, in dem die schreibende Hand stirbt während
sie schreibt und so den Grenzen des Sagbaren entgleitet, in dem Moment, in dem
die Augen trübe werden und die Qual in alle Glieder fährt, das Herz so laut
schlägt wie die Glocken eines Kirchturms und sich die Kehle zuschnürt, spürt
einer wie Linder den Bewegungen des schreibenden Körpers unerbittlich nach: Zum
Beispiel dem stotternden, hässlichen und negroid wirkenden Siegfried
Kracauer in seinen Noten an den Rand des Lebens.“
IV.
Der Schatten zündet sich eine weitere Zigarette an und behauptet mir gegenüber:
— Der stotternde Kracauer – das ist er natürlich selbst.
— „Das heißt: Er ist das Stottern Kracauers, nur das? Dieser Körper, der
nicht so will, wie der Gedanke, den er fasst? Nicht die Person Kracauers, auch
nicht das, was Kracauer schreibt, sondern dieser Bruch, das Hindernis, die Zäsur
im Sprechen Kracauers, das Holpern der Sätze selbst? Das, was nicht so
reibungslos läuft, wie es sollte, der Umweg, den die Sprache nimmt?“
— „Genau das“, sagt der Schatten.
— „Und das verstümmelte Ich Max Frischs?“
— „Kennt er auch von sich selbst“, erwidert der Schatten.
— „Nein, nein“, wende ich ein, „er ist diese Verstümmelung. Genau so wie der
Innenraum des leeren Gefängnisses, das er bei Peter Weiss diagnostiziert. Diese
Leere, das Rezeptakulum für alles und jedes, das alles in sich aufbewahrt, das
ist er!“[10]
Eines der Lieblingszitate Bruce Chatwins, das er in den Noten zitiert,
dürfte auch eines seiner eigenen Lieblingszitate sein: »Pompejus verlangte,
nachdem er in Jerusalem den Tempel gestürmt hatte, dass man ihm das
Allerheiligste zeige, und war erstaunt, dass er sich in einem leeren Raum
befand.« »Ich bin in diesem Raum,« sagt der Schatten. Als Bewohner dieses Raums
hat er natürlich einen besonderen Blick für das Inventar in den innersten,
heiligen Räumen eines Schriftstellers. In der Biographie über Heinrich Böll
steigt er in dessen tiefstes Kellergewölbe, sein Versteck, und das liest sich
so: Ein kleiner, enger, nach kaltem Moder riechender Kellerraum, in den durch
ein schmales, verdrecktes Oberfenster, hinter dem keine Außenwelt erkennbar ist,
ein Dämmerlicht fällt; unterhalb des kleinen Fensters ein Tischchen mit einem
darauf liegenden Zettel. Während ich, neugierig, ob Heinrich Böll uns eine
Geheimbotschaft hinterlassen hat, an den Tisch trete, ein flüchtiger Blick auf
die völlig verstaubten Dinge im Raum, alte Familienfotos an den Wänden, in einer
Ecke ein verrostetes Fahrrad, ein Kinderbett, ein Regal mit (offenbar gefüllten)
Einmachgläsern, in einer anderen Ecke aufeinander gestapelt mehrere Kartons mit
alten Schulbüchern und Papieren und schmalen grünen Pappkladden (die beim kurzen
Hinschauen als Volksschulzeugnisse zu erkennen sind); obenauf auch ein etwas
verschmutztes Kartenspiel. Dann stehe ich aber schon vor dem Tisch und nehme den
Zettel in die Hand. Oben rechts in Bölls Handschrift ein Datum: 19. November
1943. Der anschließende Text hat folgenden Wortlaut: Der Wortlaut dieser in
einem Brief an Bölls Mutter versteckten überraschenden Geheimbotschaft, dieses
Geheimtextes unterhalb der offiziellen Böllschen Literatur, sei hier nicht
verraten. Hingewiesen sei im Zusammenhang mit den erwähnten »Volksschulheften«
nur auf eine ganz toll klingende Behauptung Linders im Zusammenhang mit seiner
eigenen Volksschulzeit, denn da behauptet er tatsächlich im Nachwort:
Die früheste Anregung zu diesem Buch kam, wie
ich heute weiß, von Kirsten Hohage, Pestalozzi-Schule, Lüdenscheid, 1958.
Fünfundzwanzig Jahre später verführte mich Roland Barthes in seinem
Michelet-Buch, ein Leben und Werk aus sich selbst heraus zu erklären und zu
erkunden, wie ich diese Methode mit meinem eigenen Leben verbinden könnte. Dass
dann in meiner Erinnerung der Blick eines achtjährigen Mädchens wieder
auftauchte und mir noch einmal meinen Hintergrund gab, war aber doch eine
Überraschung.
„Diese Leere, das Rezeptakulum für alles und jedes, das alles in sich
aufbewahrt, das ist er!“ fasse ich noch einmal zusammen.
— Ja,
antwortet der Schatten, und insofern sind
alle seine Texte immer auch heimliche Selbstporträts. Im Text über Alexander
Kluge sagt er es ja deutlich: „Ich rede hier natürlich die ganze Zeit immer auch
von mir; sonst könnte ich das alles ja auch gar nicht sehen, wenn ich all diese
möglichen Dispositionen nicht auch in mir selbst hätte, wie jeder Mensch. Es
kann mir also im Augenblick nicht darum gehen, diese Bücher und Filme
zurückzuweisen. Aber sie sind eben kritisierbar und man kann sich davon
unterscheiden oder abgrenzen.“
— Außerdem,
fügt der Schatten hinzu, außerdem darf man
ja auch nicht vergessen, dass, was immer an Büchern zu kritisieren ist, nur
deshalb zu kritisieren ist, weil der Schriftsteller überhaupt die
Voraussetzungen dafür geschaffen hat, indem er sein Werk geschaffen hat.
— „Ja“, entgegne ich, „Werke, wie sie der an Tuberkulose erkrankte
Roland Barthes, der krankhaft narzisstische, untersetzte Max Frisch und der
spöttische, emotionslose und von innen her erfrorene Alexander Kluge
geschaffen haben. Kluge, schreibt Linder, vertote sein Material. Und
Bruce Chatwin tritt bei ihm auf als ein vom Fieberwahn befallener Krüppel,
Günter Wallraff als leidender, gedemütigter und zu Boden geschlagener
Journalist; und auch im Text über Dieter Wellershoff sitzt der Stachel tief im
Fleisch der Schrift.“
Kaum habe ich den Satz beendet, zitiert der Schatten auch schon aus den
Schatten von Dieter Wellershoff: „Und das hier bin ich. Ich fühle nur die
Stelle, wo ich sein muss, eine Stelle im Raum. Hier. Ja. Ohne mich berühren zu
können, mit den Händen. Ich habe keine Hände. Auch keinen Körper, keinen Kopf.
Aber ich bin hier. Ich bin ich.“
— „Eine sehr wichtige Stelle. Wenn es der Körper ist, der schreibt, dieser
Körper aber“ — und ich weiß schon nicht mehr, ob ich mit dem Schatten spreche
oder bloß mein eigener Zuhörer bin —, „dieser Körper ein permanent leidender
ist, ein kranker, sterbender, verschwindender, dem Vergehen anheim gegebener —
so wird er zum eigentlichen Problem der Schrift. Was taugen dann noch die Worte,
die dieser Körper in seinen unvollkommenen Bewegungen verfasst?“
— „Es gibt möglicherweise nur eine einzige Lösung“, sagt der Schatten. Franz
Liszt benennt sie in der Sommermusik: Beginne einen Satz ohne an sein
Ende zu denken, öffne ihn, lass ihn auswuchern, zeige, wie ein Bild ganz dicht
aus einem anderen hervorkommt und die Bilder, obwohl sie scheinbar nichts
miteinander zu tun haben, doch zusammen gehören und dieses Zusammengehörige auch
erschrecken kann… Zeig das Zerbrechliche, Dissonante, das rohe Fleisch der
Bilder. Zeig die Verwüstungen, die unsere Blicke der Welt zufügen… riskiere
einen hungrigen Blick, um endlich wieder einmal verliebt zu sein und alle
Aufregungen und Ängste zu spüren, den ganzen Thrill und das Abenteuer, das die
Lust ausmacht beim Leben.
V.
Das rohe Fleisch der Bilder, die Verwüstungen, der Thrill. Der Körper als reines
Erkenntnisinstrument, der Lebensmelodie auf der Spur. Das Bild des leeren
Körpers als Grundlage der Texte. Die Literatur ist nicht unschuldig in einer
Welt, in der alles nur erscheint, um zu verschwinden.
— „Aber ist es das wert? Dieses Leben am Rande des Erträglichen, das gewaltsame
Auswringen des Körpers um der Schrift willen? Ist es das wert, ununterbrochen
den Schweiß der Schrift auszuschwitzen und gegen die Sterne zu schleudern?“
— Du willst wissen,
sagt der Schatten, ob das wirklich erstrebenswert ist: Muss ein aktuell
misslungenes Leben der Preis sein für ein bedeutendes Werk? Sollte ein
Schriftsteller nicht auch versuchen, seinen Mythos zu bekämpfen? Worum geht es?
Die Welt darzustellen? Oder eine permanente Entäußerung zu erleben im Entstehen
eines Textes und in der Entäußerung eines Textes die Einverleibung von Welt?
Oder geht es darum, dahinzu kommen, zu wissen, dass die Welt auch ohne einen da
ist, um sich dann in freier Subjektivität ihr zuwenden oder von ihr abwenden zu
können? Geht es überhaupt darum, die Wirklichkeit und sich selbst in ihr
beurteilen zu können? Hat nicht jemand wie Walter Benjamin
recht – und sicher hat er recht —, wenn er feststellt, was ein Werk wie das
Prousts hervorgebracht habe, sei gewesen: »ein ausgefallenes Leiden, ungemeiner
Reichtum und eine anormale Veranlagung«, wenn er vom Schriftsteller als dem
»Regisseur seiner Krankheit« spricht, wenn er fragt: »Dürfen wir sagen, dass
alle Leben, Werke, Taten, die zählen, nie anderes waren als die unbeirrte
Entfaltung der banalsten und flüchtigsten und schwächsten Stunden im Dasein
dessen, dem sie gehören?« Aber hat andererseits nicht auch jemand wie
Sartre recht, wenn er Autoren wie Valéry und Gide, »die sich öffentlich die
Seelen putzten und glaubten, sich in ihrer nackten Wahrheit zu enthüllen«, nach
ihrem Tode hinterher rief, sie seien in Unwissenheit gestorben?
VI.
Wer schreibt, muss empfindsam sein und empfindsam bleiben, Sinn für die Melodie
der Worte haben und über eine Sensibilität verfügen, mit der man die
Bibliotheken dieser Welt niederbrennen könnte. Der muss die Fähigkeit besitzen,
sich ohne Hilfsmittel in einen Rausch zu versetzen; in einen Rausch über die
Schönheit der Sprache, der Dinge, der Landschaften in sich. Nur dann verwandelt
sich das Leiden ohne je aufzuhören. Der muss sich an die Eindrücke halten, die
sich ihm in seiner nächsten Umgebung aufdrängen.
Meine Hand führt den Bleistift über das Papier, von Wort zu Wort und von Zeile
zu Zeile, obgleich ich deutlich die Gegenkraft in mir verspüre, die mich früher
dazu zwang, meine Versuche abzubrechen und die mir auch jetzt bei jeder
Wortreihe die ich dem Gesehenen und Gehörten nachforme einflüstert, dass dieses
Gesehene und Gehörte allzu nichtig sei um festgehalten zu werden und dass ich
auf diese Weise meine Stunden völlig nutzlos verbringe. Ich richte den steifen
Körper auf, doch kaum stehe ich senkrecht, knicke ich schon wieder ein an den
Kniekehlen, im Bauch und im Nacken. Die Hände fallen von Brust und Kehlkopf
herab, die Arme schlenkern in den Gelenken. Während ich mit weit geöffneten
Augen vor mich hinblicke, entstehen allmählich aus den ungewissen, hin und her
flackernden Schatten, Strahlen, Prismen, Farbflecken und Linien die ersten
Andeutungen von Gestaltungen, anfangs unterbrochen von jähen Anflügen völliger
Schwärze. Tief unter mir liegt eine Straße und ringsum breiten sich Dächer aus,
doch die Straße ist nur eine schwarze Schlucht oder eine schmale Spalte.[11]
Ich möchte vielleicht nie erfahren,
was sich darinnen verbirgt. Wohingegen einer wie Linder die Wahrheit wissen
will, keine Frage, und darin gleicht er den Gelehrten. Er will jedoch zugleich
radikale Subjektivität, und darin zeigt er sich als Schriftsteller. Ist er am
Ende beides? Ein Intellektueller, der sich permanent selbst am Rand des Lebens
aufhält und aus dieser Ungewissheit, die dort herrscht, seine ganze Kraft
schöpft? Ist er ein poetischer Philosoph, der die Streiche, die ihm der eigene
Körper hin und wieder spielt, zu kanalisieren versucht. Schreibt er selbst, um
die Sprache seines Körpers zu verflüssigen?
— „Ich würde stöhnen“, sagt der Schatten, „wäre mir die Gewissheit
gegeben, ewig im Angesicht der Wahrheit zu leben. Was ich will, und was das
menschliche Wesen in mir will: ich will einen Augenblick lang meine Grenze
überschreiten, und ich will einen Augenblick lang von nichts aufgehalten
werden.“[12]
— „Die Funktion der Kunst ist niemals“,
belehre ich im Widerstreit mit meinen eigenen Gedanken den Schatten, „eine
Wahrheit zu illustrieren – oder auch eine Frage –, die man schon kennt, sondern
Fragen aufzuwerfen (und vielleicht auch zur rechten Zeit Antworten zu geben),
die sich selbst noch nicht kennen.“[13]
— „Das ist gut möglich“, lacht der Schatten. „Man kann darin scheitern.
Die ganze Sprache kann scheitern und in einen Sumpf der Phrasen absacken.“
— „»Ich ist ein anderer« — ist das vielleicht so ein Sumpf? Der Satz taucht
mehrmals in Linders Portraits auf“, sage ich. „Auch Carl Einsteins »Bebuquin«,
ein Klassiker der expressionistischen Literatur. Entfremdung und
Fragmentarisierung durchziehen die Noten, dieses wundersame,
unvergleichbare Buch.“
Ich mache eine kurze Pause und setze dann fort:
— „Man kann aber auch im Sumpf herumwühlen und etwas zutage fördern: Bebuquin
wirkt in seiner multiplen Persönlichkeit auf mich geradezu wie der Prototyp
jener Autoren, mit denen sich Linder kritisch auseinandersetzt. Wie eben auch
mit Peter Weiss, dessen Außenseitertum er am eigenen Leib erfährt; Weiss, den er
als gehemmt beschreibt, durchsetzt von Ängsten, dem Zwang zur Selbstbestrafung
und befangen in seiner hochgezüchteten Sprache. Oder Hans Magnus
Enzensberger, der, wie Linder sagt, bloß an seinem eigenen Mythos arbeite. Er
wird von ihm als ein doktrinärer Romantiker portraitiert, der sich permanent
selbst inszeniere, nur durch Andeutungen politisch wirke, sich stets
Rückzugsmöglichkeiten offen halte und dessen gesamte Literatur lediglich
Attitüde sei. Martin Walser attestiert er hingegen schlichtweg Lebensangst. Er
sei ein zerrissener Dandy mit der Sehnsucht nach der Lodenjacke; ein
Jäger, der nur das angreife, so heißt es weiter, was er selbst haben oder sein
wolle. Aber auch bei den von ihm geschätzten Autoren wie Roland Barthes stoßen
wir auf das Fragmentarische, das Leben als Stückwerk, zusammengesetzt aus
Zufällen, Verformungen, die zu einer literarischen Identität verwachsen sind.
Dazu schreibt er, ein Schriftsteller sei jemand, der darunter leide, dass er
sein Leben nicht erzählen könne. Literatur sei insofern gestörte
Kommunikation. Nun wird gerade in dieser gestörten Kommunikation, in der
Unfähigkeit miteinander zu leben, so lautet es im Gespräch mit Claude Simon,
der Tod sichtbar. Er steckt hinter der Maske, den Blicken und Fotografien,
von denen Linder erzählt. Zum Beispiel, wenn er John Berger einen Sekretär
des Todes nennt, der darauf hinweise, dass die Fotografie, die den
Lebensstrom unterbricht, immer mit dem Tod flirtet. Zudem durchziehen tote
Gassen und leere Zeiten fast sämtliche Portraits.“
VII.
Ich durchwühle meine Hosentaschen: Kaugummis, Bahntickets, benutzte
Taschentücher. Ich wandere in Gedanken durch die Zelte meiner Kindheit, die
Schubladen der Erinnerung, durch all die ungelesenen Bibliotheken und andere
Dinge, grabe mich blind wie ein Maulwurf durch den Tag. Ich zittere am ganzen
Körper. Es geht immer darum, zitternd das zu suchen, was die offensichtliche
Grundlage umstürzt…
Vom Garten aus blicke ich auf den Park, wo Holzkähne auf einem
kleinen Weiher treiben. Sie ähneln alten Philosophen, denen über die Frage nach
dem Ursprung allen Seins die Schatten von unten den Körper hoch kriechen. Eine
Schar Enten, stoisch und weichmütig, fängt den Nachmittag im Netz des Abends
ein. Auf den Caféterrassen unterhalten sich zwei Denker ohne zu sprechen. Die
Brandung der Hauptstraße ist kaum zu hören, und die Kähne schaukeln weiter als
gelte es, einen Dialog zu Ende zu führen. Die Welt des kleinen Dorfes in meinen
Händen wird zur Loseblattsammlung, die Schatten in dem Garten, durch den ich mit
meinem Gesprächspartner wandere, werden länger. Mein Begleiter wirkt erschöpft,
doch ich bin jetzt unerbittlich:
— „Der Flirt mit dem Tod bringt mich nochmals zurück auf Hofmannsthal“
sage ich. Hofmannsthal schreibt: „Steh auf! Wirf dies ererbte Graun von dir!“ So
raunzt der Tod den Tor an. „Ist der Schriftsteller“ frage ich den Schatten des
Körpers, „ist der Schriftsteller nicht jenem Tor vergleichbar, der, distanziert,
seinem bloßen Ästhetizismus gehorchend, erst im Angesicht des eigenen Todes zu
authentischen Gefühlen fähig ist? Einer, dessen ganzes so versäumtes Leben,
verlorne Lust und nie geweinte Tränen als Roman, als Gedicht oder Essay
aufscheinen? Als eben das Andere, das er sich selbst nicht wagt, einzugestehen?“
— „Gewiss“, sagt der Schatten. „Denn von hier aus ist alles möglich; man darf
nur nicht zur einen oder anderen Seite schwanken, man muss die beiden Seiten
weit von sich entfernt halten, man muss die vollkommene Öffnung sein, wo ich
endlich sehe, was ich will, mich mit Muße im Umgekehrten bewege — ohne zu
wachen, noch zu träumen, noch zu schlafen —; mir zum Trotz eine Fülle erschaffe
und ordne, deren ich mich erinnere und die doch neu ist, vertraut, doch nie
gekannt… als sei ich wieder an den Ort zurückgekehrt, wo alles begreifend
eindringen will… wo man sich niederlassen könnte.“[14]
VIII.
Dieser Ort… ein subjektives
Universum, offen für alles, für Träume, Bilder, Abschweifungen, Erinnerungen,
Zitate, Überlegungen, Liebe, ein Ort des Versprechens und des Begehrens — und
der Sehnsucht nach dem Ende des Begehrens, der Befriedigung, ein Ort gedacht
auch für die Verteidigung unserer Gefühle gegen die Wirklichkeit dort draußen,
träumt Liszt. An diesem Ort, wünscht er sich, müsste die Dichte der
Vergangenheit zunehmen, jeden Tag, und im gleichen Maße aber auch das Vergessen.
Der Inhaber des italienischen Eiscafés in dem kleinen Dorf in der Eifel
lässt die Jalousien runter. Das Gerippe des geschlossenen Geschäfts reckt sich
mühsam. Zeitungen von heute erzählen sich alte Geschichten und die Trottoirs
stellen ihren gebrochenen Asphalt schamlos zur Schau. Ich setze mich neben den
Schatten auf eine Wiese. An Wochentagen werden dort drüben Blumen verkauft. Und
dort Brillen, Parfums und Fisch. Brötchen, Pizza, Kaffee und Spielwaren, Schnaps
und antiquarische Bücher erwirbt, wer das nötige Kleingeld über die Ladentheke
gibt. Jeden Tag kommen die älteren Frauen bei Kerzenlicht ins Café und bestellen
Kirschtorte oder Waffeln mit Schlagsahne. Dann öffnen auch die Bordsteine
langsam wieder ihre Poren.
Da drüben, im Schatten der Burg, ist ein kleiner Flohmarkt mit alten
Fundstücken, die mich eine Zeitlang gefangen nehmen. Ich vergesse für wenige
Minuten, was ich suche, vergesse den Schatten, die Schrift, die Sprache und
blicke hinüber zu dem kleinen Markt in dem kleinen Dorf in der Eifel. Welche
Geschichte mir die Dinge dort drüben wohl zu erzählen haben? Bevor ich einen
Gegenstand kaufe, will ich alles über seine Geschichte erfahren. Woher kommt
dies Ding? Wer hat es besessen? Warum wird es verkauft? Das sprachliche Wesen
des Menschen ist, dass er die Dinge benennt.[15]
Doch wir müssen verneinen, was die Dinge voneinander unterscheidet, um die
Leere, das nackte Nichts zu erkennen. Anders als noch im 19. Jahrhundert, da die
keramischen Künste wiederentdeckt wurden und die Sammler auf der Suche nach den
Bric-à-brac, den Gebrauchtwaren, zu den Trödelmärkten und Antiquitätenläden
Europas gingen. Damals verkörperten die Dinge Gedächtnis und Glück. Die
Innerlichkeit eines jeden Jahrhunderts war ablesbar an der Dingwelt. Bin ich
selber Ding? Ich sage nicht, das bin ich, sondern da ist nur das, was um mich
herum ist, das ist die Welt, in der ich mich bewege: Da fährt ein Auto, da
steht eine Bank, ein Kind weint. Ein Flugzeug fliegt vorüber. Hundegebell.
Schweinegrunzen. Eine Terrasse voller Gäste. Ein Puppenladen, ein Teller Salz,
eine kaputte Spieldose, eine Axt, eine Säge, ein Schreibwarengeschäft, eine
Parkuhr. Der Gutshof, der schlammige Horizont, abgebröckelter Putz,
Regentropfen, ein Bücherregal, ein alter Plattenspieler… Ich suche weiter, und
leere, unendlich gedehnte Zeit, umgreift die alte Burgmauer. Unhörbare Stimmen
aus der Vergangenheit legen sich wie ein Palimpsest über den kleinen Ort. Jetzt
ertönt ein Krähenkrächzen.
Die Remittenden, die man sonst in der Auslage des kleinen Buchladens
nebenan sieht, sind verschwunden. Ein einziges, zusammengefaltetes Papier
flattert die Gassen entlang, ein Brief vergangener Tage fliegt hinauf ins
Dickicht der Spitzdächer und Hinterhofbalkone, hinaus in den Wald. Am Abend
treffen sich die Hunde am Burgplatz. Die Treppenhäuser der alten Fachwerkhäuser
knarren nun lauter unter den Schritten der müden Bewohner. Manchmal springt der
Brunnen in der Platzmitte an und lockt die Kinder herbei. Nicht weit entfernt,
zwischen korallenroten Häuserwänden führt eine Treppe in den kahl geschorenen
Himmel. Ein Kind streut Vogelfutter für ein paar verkrüppelte Tauben auf das
Pflaster. Ich wende mich wieder dem rauchenden Schatten zu:
— „Ist die Wiederherstellung von Fremdheit nicht der Anspruch, den Christian
Linder in seinen Büchern verfolgt? Ist er sich am Ende selbst zu einer großen
Frage geworden, die zu beantworten unendlich viel Kraft kostet?“
Der Schatten atmet schwer.
— „Ich meine“, setze ich fort „das gelingt hervorragend in den — mir äußerst
sympathischen — Kritiken an Wondratschek, Strauß, Walser und anderen. Gleichwohl
gibt es in seinen Texten auch das Vertraute, Diskursive in Form langer Zitate,
die nicht bloß als Räuber am Wegesrande auftreten, um uns unsere Überzeugungen
abzunehmen, wie Walter Benjamin glaubte. Nein, besonders die ein-, zweiseitigen
Einschübe in vielen Texten bezeugen meines Erachtens nicht allein den Respekt,
den er den Kollegen entgegenbringt, an ihnen entzündet sich darüber hinaus erst
das Gespräch. Durch das Zitat wird der Portraitierte lebendig, weil er selbst
zur Sprache kommt…“
Der Schatten schweigt weiter.
— „Wäre er hier“, sage ich, „würde ich ihn fragen, was ein Zitat mitbringen
muss, damit er sich persönlich auf einen Dialog einlassen kann. Und inwiefern
das Zitat ein Beitrag zur Wiederherstellung von Fremdheit ist, würde ich auch
fragen.“
Nun ergreift der Schatten noch einmal das Wort:
— Zitate, wenn sie über eine längere Strecke daherkommen, sind natürlich sein
Kompliment an die Autoren und Dank, ihn so reich beschenkt zu haben. Zum anderen
verwendet er sie in Form von Überblendungen, um die Geste eines Autors zu zeigen
(gemäß der Roland Barthschen These): »Das soll gesagt sein«.
Hinter und
in solchen Gesten verborgen sind ja die Produktionsgeschichten, die er zu
erzählen versucht.
IX.
»Mit der unbestätigten Sehnsucht nach dem Ort der Freiheit, hatte Kracauer 1931
dem unvollendeten Werk Franz Kafkas nachgerufen, bleiben wir hier,« heißt es am
Schluss des Kracauer-Textes.
Hier bleiben. Als Gast in der Gegenwart, wie es bei Dieter Wellershoff
geschrieben steht. Welcher Ort könnte damit gemeint sein? Ich denke an Linders
Text über die Schnee-Eifel: Ich bin aufs Land gefahren… Von einem überdachten
Balkon der Blick auf den Ort. Darüber ein gemächliches Geschiebe der Wolken,
über dessen Beobachtung man bald das eigene Drängen innen und nach draußen
vergisst und sich beruhigt. Zeit für Gelassenheit und andere menschliche
Möglichkeiten. Die Vögel geben ein Konzert bis in die frühe Nacht hinein. Später
in der Ferne das Bellen anschlagender Hunde. Tief in der Nacht knallt ein
Schuss, dann noch einer —da hat ein Jäger angesessen. Dann wieder Stille,
zweimal unterbrochen von dem Geräusch eines Flugzeugs als Beweis, dass da
draußen tatsächlich Menschen von einem Ort zum anderen unterwegs sind. So
vergeht Zeit.[16]
— „Welche Bedeutung besitzt die Eifel für das Schreiben Christian
Linders?“ will ich von dem Schatten des Körpers des Schriftstellers wissen, der
sich nun über andere Schatten beugt, über den Schatten der Häuser des Dorfes,
den Schatten der von Stahlgittern eingefassten Amberbäume, den Schatten der
Wolken und den Schatten der jungen Frauen, die an uns vorbeischlendern. Dann ist
auch er verschwunden, verschluckt von der hereinbrechenden Dunkelheit, dem Stück
Nacht, das ein jeder von uns in sich trägt. Nur seine schwache, rauchige Stimme
ist noch zu vernehmen:
— Welcher »Ort der Freiheit« gemeint
sein könnte, weiß ich auch nicht. Wenn du in diesem Zusammenhang nach dem
Verhältnis zur Eifel fragst – man ist hier einfach unbehelligt. Aber wie Liszt
in der Sommermusik sagt: »Meine Sehnsucht ist immer dort, wo ich nicht bin«.
Ich setze mich auf eine der vielen Parkbänke und führe das Gespräch mit
der Stimme des Schattens des Körpers des Schriftstellers fort mit dem Satz: „Bei
Liszt finden sich Charakteristika eines Lebens, die Linder in seinen
literarischen Portraits thematisiert: Das Genie, die Depression, die Ruhmsucht,
die Reisewut... In Liszts Buch der Lieder heißt ein Stück: „Oh! quand je
dors!“
Der leidende Liszt: Alles erschien ihm künstlich, die Unsichtbarkeit der Welt
und der Menschen, die Ruhe und Stille, die er als Leere empfand und für die er
keinen Ausdruck in sich ahnte. Er fürchtete diese Leere nicht, suchte sie sogar
und wollte sie bewusst herstellen in dem Wissen, dass nicht aus der Fülle,
sondern aus der Tiefe der Leere die Töne und Bilder und Wörter kommen,
die den konventionellen Blick auf
die Welt und das Leben zerstören können – aber eben nur, wenn man diese Leere
als Lehre außerhalb aller Formzwänge mit allen Risiken für die eigene Person
zuließ.
— „Aber Liszt wollte eine Sommermusik schreiben, eine leichte helle
Musik…“
— … ohne Anfang und Ende, aus dem
Nichts kommend und ins Nichts wieder verwehend, spielend mit den wenigen äußeren
Erscheinungen wie der geräumigen Wohnung im Kloster, dem Rhein, den Bäumen, den
Parkbänken, dem blauen Himmel und dem Wind, den abgemessenen Spaziergängen in
dem gepflegten Inselpark, den Nachmittagen auf der großen Wiese vor dem Kloster
mit Vögelgezwitscher und Gesprächen und Lektüren und den langen Abenden mit Wein
und bei Kerzenlicht. Ansonsten müsste die Musik nur innere Bilder herantragen,
die seinen geheimnisvollen Lebensweg beleuchten sollten. Zu Beginn der Musik
vielleicht jenes leise Fluten, das er vorhin, als der Nebelvorhang sich hob,
gehört hatte. Er hörte dieses Fluten jetzt wieder und spürte es auch körperlich
mit jeder Welle, die sanft seine Füße berührte… In dieser Musik müsste hörbar
werden… das Wehen des Windes in unseren Sätzen in diesem Sommer 1841 auf der
abgeschiedenen Rheininsel Nonnenwerth mitten in Deutschland inmitten auf einer
kleinen Kugel, die sich in einem dunkel schweigenden Universum dreht… Die Musik
sollte ein leichtes Spiel sein, das nichts beweisen will, sondern sich selbst
genügt.
— „Ein leichtes Spiel angesichts einer gespenstischen Leere der
Vergangenheit?“ Vielleicht hätte ich diese Frage nicht stellen dürfen, doch zu
spät. Zu spät bemerke ich die Angst in der Stimme, die Angst der Stimme vor der
Enge…:
Liszt überlegte: Angst vor der Enge?,
und dachte: ja genau diese Reihenfolge, Angst kommt vor Enge. Der Blick hinaus
auf den weiten Platz, er schaute sich lange um. Aber er spürte sich in dem
Augenblick nicht, wie er da saß und sich umschaute, so als seien seine Augen
ein unabhängiges Organ. Kein Gefühl; kein Gefühl für seinen Körper. So saß er da
– kalt gemacht gegen die Depression. Die Welt unerreichbar. Die Welt leer. So
war sie ihm in den letzten Tagen erschienen, kalt und unerreichbar und leer;
gespenstisch leer. Er begriff in dem Moment, dort in diesem Café sitzend, nach
dem langen mühseligen Weg dorthin, dass er eines Tages noch einmal durch die
alten Bilder hindurch musste, durch die vergessenen Erinnerungen, um sich
dahinter vielleicht zu finden als jemand anders, als ein Kind etwa, das
eigentlich immer woanders hin wollte, als es auf die Welt kam. Was würde ihn
wirklich erwarten, wenn er sich von dieser alten Welt lösen könnte? Würde er
dann nicht mehr nur auf die Fotos in seinem Inneren stoßen, sondern auf die
Welt, wie sie wirklich war, wie sie da war auch ohne ihn? Er schaute zum Fenster
hinaus, er atmete die Luft ein und hatte das Verlangen, über sich selbst zu
sprechen, über seine Augen, seine Liebe, seine Liebeslügen, seine Liebeswut und
seinen ganzen Krieg.
Bin ich Zeuge dieser Loslösung? Je mehr ich nach ihm suche, desto mehr
entzieht er sich meiner Gegenwart. Das macht mir Angst. Ich kenne die Angst,
dass, wenn man alles um sich herum zertrümmert hat, man auch sein eigenes
Inneres mit zertrümmert hat.
Angst vor der Sprachlosigkeit, dem Versagen der Stimme:
— Warum kann ich mein Leben nicht erzählen? Was hinderte ihn, in dieser
gesuchten äußeren Stille, die mit einer bewusst hergestellten inneren Stille
offenbar korrespondierte, seine Person zum Sprechen zu bringen?... Das Sprechen
rettet das Wissen, die Erinnerung an das, was war: da war doch was — was?
Lass die Sirenen singen, sagt Marie
d’Agoult.
Ein schönes Bild,
antwortet Liszt, aber auch ein bedrohliches. Natürlich bin ich nach
Nonnenwerth gekommen, damit in dieser Stille und Leere mein Unterbewusstsein
wieder zu sprechen beginnen kann, denn Phantasie entsteht ja immer in diesen
Leerstellen, die gefüllt werden müssen. Und wenn man mitten tief in dieser Leere
sitzt, dann kann man sie manchmal singen hören, die Sirenen, wie sie die
süßesten Bilder der Verführung herantragen, und man hat das Gefühl, das sei eine
totale Versprechung der Ekstase und des Glücks. Aber das ist eben auch das
Bedrohliche dieser Versprechung: Du wirst dich aufgeben, du wirst außer dich
geraten und wirst das Äußerste von dir erfahren. Die Sirene selbst ist dabei
völlig realitätsunfähig, das Verführerische an ihr ist, dass sie nur
Versprechungen macht, maßlose Versprechungen, und keine Realität gibt. Wenn man
hinkommt, ist sie ein Raubvogel, der einen zerreißt, anstatt dass sie einen
hochleben lässt. Das wusste Orpheus
und konnte nur entkommen, indem er ihrem Gesang seinen eigenen Gesang
entgegensetzte. Das wusste Odysseus, als er an der Insel vorbeikam, auf der die
Sirenen der antiken Sage zufolge zu Hause waren, und ließ sich vorsichtshalber
von seinen Seeleuten an einen Mast binden, während er ihnen befahl, sich die
Ohren mit Bienenwachs zu stopfen; deshalb konnten sie sein Flehen auch nicht
hören, ihn doch wieder von dem Mast loszubinden, damit er dieser Lockung hätte
folgen können. So hat es Homer erzählt, und genauso habe ich mir diesen alten Mythos
vom Gesang der Sirenen auch immer vorgestellt: Die antiken Seefahrer waren
monate-, oft jahrelang auf den langsamen Segel- und Ruderschiffen
unterwegs, weit weg von ihrer Heimat, und hörten immer nur das Geräusch des
Windes und sahen immer nur dasselbe, manchmal einige Vögel oder auch nicht, fern
mal ein Küstenstreifen, sonst nur das Sonnenlicht und die Wasserfläche, diese
leere Fläche – und in dieser Leere begannen die Stimmen des Inneren zu sprechen
und ihnen erotische Phantasien einzuflüstern, es war also ein Entzugssyndrom,
das die Stimmen hervorrief, denn die Leute hatten keinerlei sozialen Kontakt…
Und wir sind in derselben Situation. Diese Insel entspricht dem Schiff in der
antiken Sage, das durch die leere Weite des Meeres und der Zeit fährt.
Linder ist ein Odysseus, wie Liszt hoffend,
einmal und endlich über
sein Schicksal entscheiden zu können, vielleicht indem er einmal einem Menschen
etwas preisgeben würde, was er sein ganzes Leben lang schon in sich verbarg und
was ihn sich selbst gegenüber so fremd gemacht hatte. Er war der Fremde, in
diesem Augenblick versunken in seine sumpfigen Träume, in denen er offenbar
gerade schwer auftankte. So sah es aus. So sah er aus: wie jemand, der sein
ganzes Leben lang an einem Sommersonntagnachmittag in einem halb verdunkelten
Zimmer gesessen und seine Phantasien betrachtet hat.
Logik der Phantasie, die einen perfekten Spiegel aufbaut. Ich bin
irritiert, dass ich selber darin vorkomme und behaupte einfach, es sei nur eine
Spiegelung: Das kleine Kind, das beim Blick in den Spiegel lächelt, weil es sich
selbst darin erkennt und verlangt: Fülle mein Leben mit deinen Sätzen, damit
sie mir meine Wirklichkeit geben… um schließlich die eigene Verrücktheit
zu leben und sich der eigenen Welt zuwenden zu können, während die
Wörter obszön weiterwuchern. Alle Versuche von Verständnis und Kontrolle werden
zunichte gemacht. Die Wörter — das Einzige, was zählt, verführen das Ich, dessen
Begehren sich in den Wörtern spiegelt. In jedem Satz existiert immer etwas, das
sich über das Ich und dessen eigene Melodie lustig macht.
X.
Ich lese in der Sommermusik, Liszts Musik handele vom hier und jetzt.
Vom Wehen des Windes in unseren Sätzen. Vom Blau des Himmels. Vom Gesang der
Vögel. Vom Rauschen des Rheins. Von Nähe und Ferne. Vom Mond und von den
Sternen. Vom Vergehen der Zeit. Vom Schauen mit geschlossenen Augen, ohne etwas
zu suchen, ohne sich aufzuhalten. Von der Hingabe an die Einfälle.
Von der Hingabe an die Einfälle, an die Phantasie, vom Wuchern der
Ideen. Davon spricht auch die Literatur. Davon erzählt das Werk Christian
Linders. Doch mit diesem nicht aufgehenden Rest. Etwas bleibt unsagbar. Denn
wer sagen kann, wie sehr er brennt, ist nur ein kleines Feuer.
Das wäre auch gar nicht als Literatur zu bezeichnen. Wenn da einer wäre, der
unmittelbar die Wahrheit über sich kundtäte. Wer weiß, wer er ist und was er
will, wird sich anderer Medien bedienen. Literatur ist Verstellung, Maske,
Fassade. Ein Schutzwall gegen die Angst des Schriftstellers vor dem eigenen Ich
und seinen Abgründen und Multiplikation dieser Abgründe in den Protagonisten,
die sich der Autor in seinen Wunschbiografien herbeizitiert. Das mag als
Kulturgut ausgelegt werden, zeigt aber in den Augen Linders nur die verborgene
Seite derer, die schreibend dem Leben nachforschen und es zu erkennen versuchen:
Wer bist du, und was erfahre ich bei dir über mich selbst?
Und er hebt hervor, dass es im Grunde egal sei, ob man ein Buch rezensiert
oder einen Menschen beurteilt. Denn das Buch, das er geschrieben hat, das ist er
selbst, sein Symptom.
Die Stimme pflichtet mir bei, ist aber um Differenzierung bemüht:
— Natürlich ist die These nicht
falsch, die jedem Schüler eingepaukt wird: der Erzähler in einem Buch oder das
lyrische Ich darin – das sei nicht der Autor; also Stiller, Gantenbein, Walter
Faber – das sei niemals Frisch; natürlich nicht. Natürlich löst sich ein Text
vom Autor und führt ein Eigenleben, ein Buch kann daherkommen als Flaschenpost,
treibend in dem großen gesellschaftlichen Leben – aber ein Schriftsteller, das
kann nicht oft genug gesagt werden, spricht aus seinem Leben heraus und möchte
sein Leben erzählen, und weil er es nicht kann und weil er darunter leidet, dass
er es nicht kann, schreibt er seine Bücher und nutzt die Strategie, Teile des
eigenen Unterbewusstseins, der eigenen verbotenen Phantasiewelt dadurch
angstfreier freilegen zu können, dass er scheinbar von anderen, erfundenen
Personen spricht – nur die wenigsten Schriftsteller sind solche starke
Persönlichkeiten, dass sie es schaffen, die Sperren direkt, sozusagen
autobiographisch zu überwinden. Deshalb, wie es oft getan wird, zu verlangen:
Finger weg vom Autor – das ist eine Beleidigung für jeden wirklichen
Schriftsteller. Insofern braucht man überhaupt keine Skrupel haben, wenn man auf
die Suche geht nach den Erfahrungen, aus denen heraus ein Schriftsteller seine
Bücher geschrieben hat – wenn es auch grundsätzlich natürlich immer
problematisch ist, in das Leben eines Menschen hineinzusprechen. Aber hier geht
es um Literatur, eine öffentliche Angelegenheit. Warum sollte deshalb solche
Beschäftigung zu indiskret, zu intim sein? Alles, was ein Schriftsteller an
Materialien anbietet, ist öffentlich. Alles, was aus den veröffentlichten Texten
erschließbar ist, darf gesagt werden. Jede Frage darf gestellt und beantwortet
werden, soweit das Werk selbst Antwort gibt.
XI.
— „Zum Beispiel die Frage, ob es befriedigender sei, sich in der Welt
auszubreiten statt in ihr hoch zu wachsen?“
— „Ja, natürlich.“
— „Und?“
„Ich würde mich gerne in der Welt ausbreiten“, sagt die Stimme des Schattens,
den ich nicht mehr sehe, „aber die Schriftsteller müssen hoch wachsen, weiter
wachsen. Dort oben ist es dann immer noch möglich, sich auszubreiten, weil dort
nicht mehr so viel wächst. Ist man erst einmal da oben, ist es leicht, sich in
der Welt auszubreiten. Wäre ich Schriftsteller, ich würde ein Buch nur mit
Wolkenbeschreibungen füllen, ohne jede Handlung.
—
Marie d´Agoult aber sagt zu Franz Liszt in der Sommermusik: Jeder
hat das wahre Leben. Was hast du da für eine seltsame Sehnsucht nach einer
anderen, wahren Biographie? Wenn wir auch alle unser Leben in unserem Handeln
und Denken erfinden, so macht das doch nur Sinn, wenn wir dabei auf uns zu gehen
und nicht von uns weg, weg zu einem Ideal.
— „Richtig, das sagt Marie
d´Agoult, nicht Franz Liszt. Deshalb schreibt sie am Ende das Capriccio zu
Liszts Musik auch nicht. Deshalb verstummen die Vögel, wenn Liszt zu spielen
beginnt. Deshalb trennen sich die Wege der beiden schon bald. Deshalb leben sie
verschiedene Leben.
»Was willst du?«, fragt Marie
d’Agoult Liszt. »Der Welt nicht mehr gefallen müssen,« lautet die Antwort.
>Marie d’Agoult ist völlig verblüfft und sagt
sofort: »Der Welt nicht mehr gefallen müssen? Wollen? Aber stimmt das denn?
Denn hier, in deinen Sätzen und Noten, verführst du ja richtig, führst
durch deine Welt und führst auch durch deine Leerräume und zeigst die
Ausstattung, zeigst, was in dir klingt und dich bewegt, aber es ist nie so, dass
du sagst: Das bin ich, sondern du sagst: Das ist das, was um mich herum ist, das
ist die Welt, in der ich mich bewege. Wenn das deine Identität ist, dann
müsstest du spätestens in dem Augenblick, in dem du dich dem anderen aufdrängst,
dich erst selbst entdecken, als jemand, der stark ist oder banal oder wie auch
immer, das ist unbekannt. Denn so, hier, in deiner Musik, gefällst du ja
wirklich, und du hast es auch so leicht zu gefallen, weil ja jeder in dieser
Musik sich wiedererkennen und eine Welt entdecken kann, die er vielleicht immer
schon erahnt hat, die bei ihm aber nie wirklich durchgedrungen war bis zur
Wahrnehmung. Aber – bist du das denn? Hast du es nicht so gemacht, dass der
andere das Gefühl hat, er sei es?«— „Geht es also letztlich immer nur um die Frage, wie man seine
Lebensbehinderungen produktiv machen kann? Ist das nicht ein Unbehagen
verursachendes Denken? Ein Denken, das bis zum Äußersten geht?“
— „Ich denke“,
sagt die Stimme, „ich denke, in den »Noten« gibt es
viele Vorschläge, die Linder daraufhin prüft, ob sie praktikabel sind.
Schlüssige Antworten besitzt er natürlich auch nicht. Die für ihn selbst beste
Antwort findet sich im Text über Vilém Flusser, indem er die alten Fragen
stellt: »Wie setzt man sich mit der skandalösen Tatsache auseinander, dass nach
dem Gesetz des Zufalls der eine dieses Lebenslos bekommt und der andere jenes?
Wie geht man mit dem Problem um, dass die einmalige Chance des Lebens so
ungleich bemessen wird, wie geht man mit der Zufälligkeit von Glück und Unglück
um, wie mit der Kontingenz? Fragen, die man letztlich gar nicht beantworten
kann, weil in jeder Antwort immer auch eine unlebbare Konsequenz steckt.“
Die einzige Antwort, die er dann riskiert, lässt er Liszt sagen: Ich kenne
nur eine Regel: Alles so gut zu machen, dass das, was man heute gemacht hat,
wahrgenommen hat, überhaupt gewesen ist und von einem selbst den anderen gegeben
hat, gut genug war für diesen Tag und an diesem Tag.
So bleibt am Ende nichts anderes übrig, als in der eigenen Gegenwart
weiterzuleben, so dünn sie einem auch erscheinen mag. Gefällt es dir hier,
Franz?, fragt Marie d’Agoult. Ja, es gefällt mir. Obwohl immer etwas
fehlt. Hier bin ich zwar, dies ist meine Zeit, doch zugleich bin ich mit meinen
Erinnerungen in der Kindheit und mit den Phantasien im nächsten Jahrzehnt, so
dass ich niemals den Platz ausfülle, auf dem ich jetzt gerade in diesem Moment
lebe… Deshalb wird er seine Sommermusik auf Nonnenwerth auch nie schreiben,
weil er eigentlich mitten in diesem Sommer 1841 schon vom nahenden Herbst und
Winter träumt und weiß, dass man den Traum einer Sommermusik nur im Winter
schreiben kann und die darin auszudrückende Stille vielleicht sogar eine
Winterstimmung ist. Insofern ist das Buch Sommermusik wieder eine Lektüre
von Nie-Geschriebenem. Mit dem Glücksgefühl des Weitermachens, der wartenden
Arbeit: Er dachte an das leere weiße Papier, das sein Leben war und zugleich
immer auch die Chance, aus Nichts ein Stück zu machen, dieser alte Traum, das
Nichts an Stoff zu nützen, indem er das Papier mit seinen Noten füllte, die ihm
seine Wirklichkeit geben sollten. Er hatte wie immer vor Beginn einer Arbeit
keine Ahnung, wie diese Wirklichkeit aussehen könnte. Er war sich auch nicht
sicher, ob er überhaupt einen Sinn oder eine Funktion suchte. Eigentlich will
ich doch nur die Farbe Blau zeigen, dachte er, das Blau des Himmels bei
bestimmten Lichtverhältnissen, oder vielleicht will ich auch nur den Grundriss
einer Wohnung zeichnen, den meine Augen in einer vergangenen Zeit einmal gefilmt
haben und der sich auf meinem Körper, in meiner Art, mich durch die Welt zu
bewegen, abgedrückt hat. Einen Augenblick noch, dachte er, noch einen kleinen
Augenblick.
Ein langer leichter Sommersonntagnachmittag… Dasselbe Gefühl der
immer neu erstehenden Fülle, des ständigen und bleibenden Überschwanges, wenn
ich dort durch die weiße Holzpforte hinaus, den trockenen Weg entlanggehe, der
zu den Wiesen hinunterführt. Da laufe ich an der nassen Wäsche vorüber, die auf
der Leine hängt…, da bin ich bei den Heuschobern und den Karren, deren Deichseln
auf die Erde hängen; da schaue ich von weitem über den unsichtbaren Fluss, über
den blaugrünen Wald im Hintergrund, der allein die Hitze erträgt, diesen
Horizont aus Pflanzen zeichnet. Licht, summendes Gras, Fliegen, der Geruch des
Misthaufens, und weit und breit keine Menschenseele… Und da ist wieder das
sonnenerfüllte Zimmer. Über dem Bett schneidet das Licht ein Rechteck aus der
gelben Wand. Der Kamin, der Spiegel, die Kommode, die roten Sessel, der Tisch,
das Bett, alles steht an seinem Platz… die weißen Möwen stürzen, fliegen… die
Luft erschaffend, dahinschwebend, aus dem Licht hervorgegangen… Durch das Laub,
die Zweige… Grenzenloser Tag ohne Umrisse, anschwellend von der Geschichte und
den Völkern, von Zufall und Zukunft… In den uneinnehmbaren, frisch beschnittenen
Spindelbäumen… die verschlüsselten Gespräche… Und ich laufe durch die laue,
lichterbunte Nacht, ich erreiche den zu dieser Stunde einsamen Park, ich laufe
durch die dunklen Alleen, ich springe auf die Bänke, die eisernen Stühle, werfe
sie um; ich laufe erleichtert, befreit, zwischen den Bäumen hindurch, das
Gesicht zurückgeworfen, verloren, mich verlierend…[17]
Ich suche den Schriftsteller Christian Linder und finde immer nur mich
selbst. Ich glaube nicht, dass ich etwas sagen wollte, was über das
Geschriebene hinausgeht. Ich meine, dies ist die realistische Erzählung eines
Mannes, der eine Existenz am Rande der Gesellschaft führt, unter Menschen, die
genauso abgeschnitten sind vom normalen Leben wie er.[18]
Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich langsam über die lange, dunkle Straße
wieder nach Hause gehe.
[1]
Jörg Fauser, Strand der Städte (Schlaflos in der Zwischenzone).
Berlin 2009.
[2]
Philippe Sollers, Der Park. Frankfurt a.M. 1963.
[3]
Christian Linder, Noten an den Rand des Lebens. Portraits und
Perspektiven. Berlin 2011.
[4]
Christian Linder, Sommermusik. Ein Liebestraum Franz Liszts.
Capriccio. Berlin 2011.
[5]
Wenn nicht anders angegeben, entstammen die Kursivpassagen den
Texten und Worten von Christian Linder. Der Text geht auf ein Treffen
zwischen uns in Nideggen am 26.09. 2011 zurück. Teils habe ich auch
Passagen aus unserem Mailverkehr in den Text einfließen lassen. Der Text
arbeitet also wie Linder auch mit steten Überblendungen und versteht
sich insofern als Hommage an die Schreibweise des Schriftstellers.
[6]
Hugo von Hoffmannnsthal, Der Tor und der Tod. Frankfurt a.M. 1913.
[8]
Christian Linder, Der Bahnhof von Finnentrop. Eine Reise ins Carl
Schmitt Land. Berlin 2008.
[9]
Christian Linder, Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils. Heinrich
Böll. Eine Biographie. Berlin 2010.
[10]
Vgl. hierzu Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse. Hamburg 1999.
[11]
Paraphrasiert nach Peter Weiss, Der Schatten des Körpers des
Kutschers. Frankfurt a.M. 1960.
[12]
Georges Bataille, Werkausgabe, Artikel II 1950-1961. Paris
[13]
Alain Robbe-Grillet, Argumente für einen neuen Roman. München 1965.
[15]
Walter Benjamin, Über die Sprache des Menschen. Frankfurt a.M. 1977.
[16]
Christian Linder, Landleben, ein Traum. Über den Fluß und die Wälder —
Spurensuche in der Schnee-Eifel. In: Lettre International 91 (Winter
2010).
[18]
Peter Weiss im Gespräch. Frankfurt a.M. 1986.
Artikel
online seit 05.02.20
|
Das Essay als
pdf
Christian
Linder
Noten an den Rand des Lebens
 Portraits und Perspektiven Portraits und Perspektiven
Matthes & Seitz Berlin
797 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
978-3-88221-606-6
€ 44,00 / CHF 58,90
Christian
Linder
Sommermusik
Ein Liebestraum Franz Liszts. Capriccio
 Mit zahlreichen Fotografien von Bernd Weingart Mit zahlreichen Fotografien von Bernd Weingart
Matthes & Seitz Berlin
422 Seiten
978-3-88221-560-1
€ 29,90 / CHF 41,90
Christian
Linder
Heinrich Böll.
Das Schwirren des
heranfliegenden Pfeils.
 Eine Biographie Eine Biographie
Matthes & Seitz Berlin
624 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
978-3-88221-656-1
€ 29,90 / CHF 41,90
Christian
Linder
Der Bahnhof von Finnentrop
Eine Reise ins Carl Schmitt Land
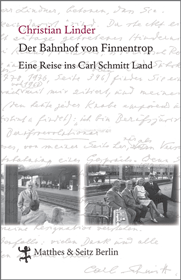 Matthes & Seitz Berlin Matthes & Seitz Berlin
478 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
978-3-88221-704-9
€ 34,90 / CHF 47,90
|

 Portraits und Perspektiven
Portraits und Perspektiven Mit zahlreichen Fotografien von Bernd Weingart
Mit zahlreichen Fotografien von Bernd Weingart Eine Biographie
Eine Biographie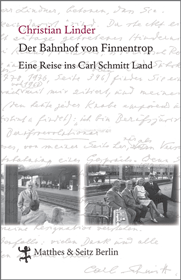 Matthes & Seitz Berlin
Matthes & Seitz Berlin