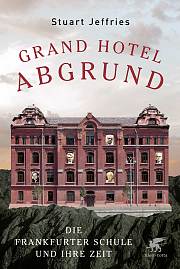|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
»Mach's
gut und danke für den Fisch.« |
||
|
Great expectations – aber dann leider viel Lärm um nicht viel In Gustav Flauberts Roman Bouvard und Pécuchet von 1881 machen zwei kleine Kanzleischreiber, die sich gleichsam in einer frühen Homo-Ehe zusammentun, eine Erbschaft. In der Folge sind sie wohlhabend und probieren auf ihrem Landsitz alles aus, was die Wissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts hergibt. Dafür lesen sie zuvor die entsprechenden Traktate. Das Besondere an dieser großen Erzählung ist, dass die Protagonisten keiner einzigen der bearbeiteten Schriften der Astronomie, Agrikultur, Philosophie oder Literatur ein tieferes Verständnis entgegenbringen. All ihr Fleiß und Eifer im Sammeln und Zusammentragen führt am Ende in diesem Roman der hochgesteckten Ziele immer wieder zu demselben Ergebnis – eines geschwätzigen Scheiterns an den unverstandenen Grundvoraussetzungen der Wissenschaft. Zu diesem satirischen Zeugnis einer profunden Halbbildung kann man sich ein modernes Gegenstück denken. Es handelt sich um die Darstellung der Kritischen Theorie mit dem Titel Grand Hotel Abgrund. Die Frankfurter Schule und ihre Zeit. Sie stammt von dem Journalisten des englischen Blattes »The Guardian«, Stuart Jeffries. Ein frischer Wind? Das Buch nimmt für sich selbst in Anspruch, die Kritische Theorie in ihrer Epoche, also in die Zeit des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts, im Schoße der wichtigsten Kulturdebatten abzubilden. Der Autor geht frisch zu Werke, teilt den Text in Kapitel zu Dekaden ein, setzt seine eigenen Akzente und berichtet in einem gelehrten Plauderton eines Sachcomics, der nicht nur in England viele Kritiker überzeugt hat, vor dem Hintergrund der Popkultur über Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Henryk Grossmann und Jürgen Habermas. Das erste Kapitel wird von der Kindheit her gedacht (»Am Anfang anfangen« ist eine Parole Aldous Huxleys aus Brave New World), das zweite vom Generationenkonflikt und Ödipuskomplex, das dritte über die Zwanzigerjahre und die Gründerzeit des Instituts für Sozialforschung aus architektonischer Perspektive des Gebäudes und so fort. Es sind kulturwissenschaftliche Ausblicke von der Popkultur aus, die neben von den cultural studies auch stark von den angelsächsischen german studies geprägt sind: die Theorie der Weimarer Epoche scheint hier im Fokus auch der Methode zu stehen. Das könnte erfrischend sein, wenn man solche Einteilung gegen eine sukzessive Erbsenzählerei der Fünfziger- und Sechzigerjahre hielte, wie das beispielsweise in der Neuen Geschichte der deutschen Literatur von David Wellbery gelingt, die ebenfalls kulturelle Anlässe, Stichtage und Dekaden als Ordnungsprinzipien nimmt. So heißt es auch bei Jeffries: »Im Jahr nach der Premiere von Mahagonny wurde Max Horkheimer Leiter des Instituts für Sozialforschung.«[1] Jeffries fasst dabei das noch einmal griffig zusammen, was er anderen Biografien, hauptsächlich von Martin Jay, Wilfried Menninghaus, Stefan Müller-Doohm oder Eiland und Jennings Benjamin-Biografie entnimmt. Der unbedarfte Leser traut seiner Erklärung aus der Einleitung, dass Jeffries zwar kritisch bleiben, aber die kritische Theorie auch gegen falsche Anfeindungen verteidigen will: Kurz: die Frankfurter Schule verdient es, dass man sie vor ihren Verleumder in Schutz nimmt, vor denen, die wissentlich oder unwissentlich Leistungen jener für eigene Ziele eingespannt haben. Außerdem muss man sich von der Vorstellung befreien, dass sie uns heutzutage, in einem neuen Jahrtausend, nichts mehr zu sagen hat.[2] Gröbste Vorurteile unter liberaler Hülle Im Verlauf der Lektüre aber muss der Leser bald verdutzt feststellen, dass es hier gar nicht um eine neutrale Darstellung geht. Vielmehr unternimmt Jeffries selbst den Versuch einer Denunziation unter einer diskursiven Hülle und bekräftigt so die gängigsten bekannten Vorurteile. Das beginnt bereits in der Einleitung. Dort macht er klar, dass es sich bei der Kritischen Theorie um eine angeblich »eklatante Verkehrung von Marx‘ Denken« handele (S. 9). Der Vorwurf, den er mit dem Titel von Georg Lukács übernimmt, ist derjenige der Lehnstuhl-Philosophen, der cosy armchair-philosophers, die es sich am Rande des Abgrunds permanent gemütlich gemacht und sich dort so einquartiert hätten, dass sie auch nicht mehr wegwollten: In dieser Sphäre fühlten sich die Denker der Frankfurter Schule am wohlsten – anstatt sich von wahnhafter Revolutionseuphorie anstecken zu lassen, zog man es vor, sich in einen nichtrepressiven intellektuellen Raum zurückzuziehen, wo man frei seinen Gedanken nachgehen konnte. Diese Art von Freiheit ist natürlich eine Freiheit melancholischer Art, da sie aus dem Verlust an Hoffnung auf echte Veränderung entsteht. Wenn man sich allerdings mit der Geschichte der Frankfurter Schule und der Kritischen Theorie auseinandersetzt, dann entdeckt man gleichzeitig, wie sich diese Denker, sieht man einmal von Marcuse ab, zunehmend ohnmächtig angesichts von Mächten fühlten, die sie zwar verachteten, aber auch für unüberwindlich hielten.[3] Ja, aber stimmt das denn? Hatte nicht Adorno selbst schon früh einen solchen Zustand, den Jeffries ihm und seinen Kollegen hier unterschieben will, kritisch als eine falsche »Sommerfrische des Denkens« im Auge? Den geisteswissenschaftlichen Psychologen jedenfalls wirft er 1927 vor, eine solche Sphäre ohne Ökonomie zu konstruieren.[4] Wenn Jeffries das nun Adorno und den anderen vorhält, handelt es sich um eine simple Retourkutsche – die, wie es bekanntlich im Kinderspiel heißt, nicht mitnimmt. Das ganze Buch ist so eine leere Rückkutsche, es kultiviert Ressentiment. Es ist böse Jeffries paraphrasiert also die anderen Biografien anscheinend nicht nur, er versucht sie in seinem Sinne zu ergänzen und umzuwidmen. In jedem Kapitel platziert er geschickt solche tendenziösen Sottisen: wenn er beispielsweise über Benjamin und sein Kindheitsbuch schreibt, dann beschreibt er diesen als lebensuntüchtigen Bohemien: er wird nach einem Urteil von Hannah Arendt als jemand geschildert, der sich angeblich gegen ein praktisches Leben und dafür entschieden hätte, seine Habilitation nicht zu bestehen. Benjamin war demnach unfähig, ein unheilbarer Melancholiker, ein Versager: Im-Aussterbeprozess jenes europäischen Typs gab es also einen kurzen, intensiven Lichtblitz – die Schriften Walter Benjamins. Wenn die Frankfurter Schule der Schwanengesang der deutschen Romantik war, dann war Benjamin deren Inbegriff, in ihm kamen all die Widersprüchlichkeiten der Gruppe zum Ausdruck – Marxisten ohne Partei, Sozialisten, die vom Geld von Kapitalisten abhängig waren, Nutznießer einer Gesellschaft, die sie naserümpfend verachteten und ohne die sie nichts gehabt hätten, worüber sie hätten schreiben können.[5] Beim Schwanengesang handelt es sich um das letzte Lied vor dem Tod. Damit wird Benjamin exemplarisch zum Prototyp auch der anderen schmarotzenden jüdischen Intellektuellen, die von den Geldern ihrer Väter leben. Möglich, dass Jeffries hier seine wahren Motive deutlich macht: Es scheint eine Unterscheidung zwischen »schaffenden« und »raffendem«, unproduktiven Kapital zu sein, die schon Goebbels bevorzugte, um die melancholischen Schmarotzer jüdischer Kultur als Schlangen am Busen der arbeitenden Deutschen zu kennzeichnen. Statt also der Schaffenden, haben wir hier nun diese Leute mit Selbstmordgedanken und entsprechend körperlich unfit – hämisch wird von Jeffries eine Anekdote kommentiert, wo Benjamin selbst beschreibt, dass er sich an dem Bug eines bereits abgefahrenen Schiffes hoch hangelt – das traut man ihm ja bekanntlich nicht zu (S. 205). Jeffries argumentiert aber nicht direkt antisemitisch, bei ihm steht anscheinend ein wirtschaftsliberales moralisches Konzept im Hintergrund, ein survival of the fittest. Zu solchen Fitten gehören die Frankfurter aber anscheinend deswegen nicht, weil sie mit jüdischem Geld hantieren. Ein merkwürdiger Vorwurf. Ein merkwürdiges Buch Zugleich wimmelt es im ersten Kapitel von Fehlern: Das Schulhaupt der Frankfurter Theorie ist Horkheimer und nicht Adorno (der Werbetext von Klett-Cotta macht Adorno zum »Papst«, Horkheimer dagegen zu »Aussen- und Finanzminister« der Frankfurter Schule); Horkheimers Eltern und auch die von Benjamin waren Millionäre, Adornos dagegen nur wohlhabend. Der Begriff »kritische Theorie« wird nicht 1930 von Horkheimer verwendet, sondern erst 1936 in seinem Essay »Traditionelle und kritische Theorie«, vorher spricht er von »ökonomischer Theorie«. Der Begriff ist nicht gegen »feige intellektuelle Tendenzen gerichtet«, wie Jeffries schreibt – es gehört schon einige Chuzpe dazu, als solche »feigen Theorien« den logischen Positivismus, eine wertfreie Wissenschaft oder die positivistische Soziologie anzuführen (S. 33) und so fort.[6] Wenn das also ein in Schutz nehmen der Kritischen Theoretiker sein soll, dann möchte man nicht wissen, wie ein Angriff aussähe. Keine Zufälle Das zweite Kapitel über die 1920er Jahre enthält neben der Abhandlung marxistischer Probleme der Ideologie oder der Entfremdung im Stile von Reader‘s Digest, immer wieder die Anschuldigung, die Söhne ihrer reichen jüdischen Väter hatten auch als Professoren (von deren Lehrstühle die Nazis sie vertrieben) nichts Wirkliches zustande gebracht – sie lebten ja von der Donation des jüdischen Weizenhändlers Weil – und ließen sich also von dem kapitalistischen System aushalten, dass sie auf diese Weise bequem kritisierten. Die Interdisziplinarität des Programms des Instituts für Sozialforschung wird entsprechend zu einer »Zwangsehe von Marxismus und Psychoanalyse« (S. 185) herabgewürdigt. In Amerika sprechen die Emigranten dann undankbar von einer »Hölle« und wagen es dreist, Hollywood und die Kulturindustrie mit den Propagandaveranstaltungen des Dritten Reiches zu vergleichen oder gar von Antisemitismus in Amerika selbst zu sprechen! (S. 139) Die Dialektik der Aufklärung wende sich vom Proletariat ab und setzte stattdessen die negativistischen Intellektuellen selbst als Subjekte des vermiedenen Klassenkampfes ein. (»Die Dialektik der Aufklärung unterstrich den Abschied der Frankfurter Schule ihrer vormaligen Festlegung auf den Marxismus sowie ihren Absturz in die Verzweiflung)«. (S. 284) Bei der Rückkehr nach Deutschland machen sie dann einen bequemen Frieden mit dem Staat (Horkheimer) oder ziehen sich mit einem »unnützen und antimarxistischen Buch« wie der Negativen Dialektik (nach Kolakowski) vollends in die ästhetische Esoterik zurück (Adorno) (S. 387). In Amerika propagierte Marcuse derweil heuchlerisch eine vermeintliche Sexualbefreiung, während er sich in seinem Privatleben als Pascha weiter von Frauen aushalten ließ, Jugendliche zu Terrorakten anstiftete und selbst – mal mit Plüschnilpferden, mal mit jungen Studentinnen auf dem Schoß – der Pornoindustrie und dem Playboy zuarbeitete. (S. 372) Überhaupt sei die Kritische Theorie der ersten Generation kaum der Rede wert; erst Habermas habe sie überhaupt diskutabel gemacht. (S. 423) So geht es unter der Camouflage eines gelehrten Diskurses und der feindlichen Umarmung lustig voran. Es handelt sich hierbei nicht um eine immanente Kritik, sondern um eine böse von außen, die sich mit dem Versuch eines Verständnisses der anderen Position nicht wirklich abgibt. Mit Jeffries zurück zum Kalten Krieg Hat der Leser also voller Erstaunen über die entsprechenden Stellen die Lektüre unter Mühen hinter sich gebracht, so muss sein erstes Urteil einer zufälligen Harmlosigkeit und Absurdität revidiert werden. Das Buch erscheint genau und schlau kalkuliert. Es handelt sich, wo Jeffries nicht auf die anderen Biographien zurückgreift, anscheinend um die Erweiterung von zwei Interviews, um die es herumgebaut ist. Diese hat der Journalist vor einiger Zeit mit Angela Davis und mit Jürgen Habermas für den Guardian geführt. Sie füllen das 15. und das 17 Kapitel: im Ersten wird Herbert Marcuse gezielt denunziert (»An dieser Stelle dürfte es nützlich sein, näher auf Herbert Marcuses Sexleben einzugehen.«) (S. 372) und im Zweiten Jürgen Habermas‘ Umschreibung der Kritischen Theorie der ersten Generation über den grünen Klee gelobt – nun sei die Theorie erst zu sich selbst gekommen.[7] Dass Habermas heute allerdings eine ähnliche sozialdemokratische Position einnimmt, wie er Horkheimer früher vorgeworfen hat, findet sich nicht bei Jeffries. Diese beiden Interviews bilden anscheinend einen Ausgangspunkt. Bei allen anderen Kapiteln handelt es sich gleichsam um einen erweiterten Füllstoff in genau diesem Sinne einer gezielten Denunziation. Er ist die in eine äußere Form gebrachte und erweiterte Veröffentlichung seiner Skizzen, Exzerpte, Vorbereitungen und Materialien für diese Gespräche – Hilfslinien, die der Journalist wegen ihres ephemeren und offen pejorativen Charakters besser hätte wegradieren sollen. Unter solcher Voraussetzung lässt sich Jeffries nicht wirklich auf seinen Gegenstand ein. Die von vielen Kritikern verwundert registrierten kleinen inhaltlichen Fehler besitzen daher nicht den Charakter von verzeihlichen faut pas, sondern sie sind Symptome und verweisen auf fehlende profunden Kenntnisse, die durch die Lektüre der anderen geplünderten Biografien nicht kompensiert werden können. Vor allem fehlt ein Verständnis der Grundperspektive als einer Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung. Wie die beiden ehemaligen Schreiber bei Flaubert, die alles lesen, aber nichts begreifen, verfehlt auch der Journalist des Feuilletons, der zum Philosophen werden will, das Verständnis des Ansatzes der Frankfurter Theorie. Er verbleibt an der bei allen vordergründigen Diskursen doch unbewegten Oberfläche der von keiner Lektüreerfahrung angekränkelten Vorurteile: Das ganze Buch hindurch wird unmissverständlich positiv grundsätzlich gegen negativ gehalten, als wenn Hegel nie gelebt hätte; die unproduktiven Intellektuellen rebellieren ödipal gegen ihre schaffenden Väter und die Frankfurter bleiben ihr Leben lang lebensuntüchtige und verspielte Melancholiker nach dem Prototyp Walter Benjamins. Dass England selbst – von Shakespeares Adaption der dänischen Hamletfigur, über Robert Burtons Anatomie der Melancholie und dem Buch Saturn und Melancholie der Emigranten Erwin Panofsky, Fritz Saxl und Raymond Klibansky bis hin zum Wahlengländer W. G. Sebald mit Die Ringe des Saturn – eine solche Dialektisierung der Schwermut hervorgebracht hat, hat es anscheinend nicht in den kulturellen Kanon von Jeffries Bildung geschafft. Er bezieht sich dagegen lieber – hoch lebe die Popkultur! – auf »intellektuelles Kryptonit«, den Dichter H. D. Lawrence (den Autor von Lady Chatterley, den Ernst Bloch nicht zu Unrecht unter die »Tarzan-Philosophen und Penisdichter« rechnet) oder auch auf den »berühmten Dialektiker Homer Simpson« aus dem Simpson-Comic von Matt Groening. Undialektische Sensationen Über die Verwunderung über den Widerspruch, der bereits bei Marx und Engels zu konstatieren ist, dass nämlich der Sohn des Fabrikbesitzers Engels gegen seine Klasse schreibt, kommt Jeffries nicht hinaus. Wieder und wieder repetiert er, was ihm auf diese Weise sensationell widersprüchlich erscheint: dass die Frankfurter aus der Kapitalistenklasse stammen und sich für das Proletariat einsetzen, aber ihre bürgerliche Distanz nicht einfach aufgeben wollen. Um solche Position zu verstehen, müsste er sich auf eine dialektische Logik einlassen. Das aber will er anscheinend um keinen Preis. Ihre dialektische Kritik an den Säulenheiligen des angelsächsischen Pragmatismus wie David Hume, John Dewey, Bertrand Russell oder auch Karl Popper müssen Herbert Marcuse und die anderen in dieser Studie umgekehrt damit bezahlen, dass sie riduculisiert und zudem moralisch schlechtgemacht werden (S. 280). Man hat den Eindruck, dass es allein der Grad dessen, wie nah sie den Positivisten kommen und diese zustimmend rezipieren, für Jeffries ihren Stellenwert bestimmt. Da versteht er keinen Spaß. Entsprechend lässt er seine Geschichte der Frankfurter Schule in Habermas und in Honneth auslaufen, die für ihn die größte Nähe zu den angelsächsischen Philosophen aufweisen. Von einer umfassenden und kritischen Darstellung hätte man sich mehr und vor allem anderes erwartet als eine alerte Bestätigung dieser gröbsten Vorurteile unter einer diskursfreundlichen Hülle, deren Autor alles gelesen haben will, aber anscheinend nichts verstanden hat. Eine vorgetäuschte Tiefe Diese Grundkonstruktion von Jeffries Buch erschließt sich freilich erst einem genauen Hinsehen. Er selbst hat anscheinend eine diebische Freude daran, den Leser durch die Zitation und Beibringung verschiedener unterschiedlicher Stellungnahmen und eigenen sprunghaften Assoziationen zu verwirren, darunter aber die kritischen Theoretiker selbst zu kritisieren, sie also zugleich mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Dagegen und auch gegen eine Skepsis gegenüber Säulenheiligen, ist nicht nur nichts zu sagen, sie ist selbstverständlich von einer intellektuellen Gruppenbiografie zu fordern. Aber Jeffries platziert unter der Maske der Skepsis in Wirklichkeit eine haarsträubende subjektivistische Verleumdung. Als Einführung in den Themenkomplex ist das geschmäcklerische Buch daher nicht zu gebrauchen. Es stiftet eher unheilvolle Verwirrung von der Art, dass den Stein, den ein Narr ins Wasser geworfen hat, auch zehn Weise nicht wieder heraufholen können. Nicht alles ist falsch an diesem Buch, aber man kann auch andererseits nicht kompletten Unsinn schreiben, auch wenn man sich ernsthaft darum bemühte. Im Wesentlichen mangelt es Jeffries an einer entsprechenden Perspektive; er steht dem Gehalt und der Methode der Kritischen Theorie fremd und feindlich gegenüber und kapriziert sich auf Akzidenzien und Nebenwidersprüche. Das mag auch damit zu tun haben, dass er sich neben seinen eigenen Gesprächen wesentlich auf Sekundärtexte und Biografien stützt – was angesichts der Materialfülle verständlich ist. Das Buch ist dabei durchaus antizyklisch gehalten. Denn dagegen bemühen sich gerade überall auf der Welt ältere und jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Adorno und die Frankfurter Schule neu und differenziert zu interpretieren: Brandon Bloch in Amerika über Adorno, Peter Gordon über Adorno und Kierkegaard, in Kolumbien Laura Flórez und Sebastian Tobón über Neuinterpretation der ästhetischen Theorie und Mimesis, Eva-Maria Ziege über eine Neubewertung des Antisemitismus, Anthony Kauders über die Psychoanalyse, Helmut Dahmer über politische Organisationsfragen, Michael Schwarz und die Musik – um nur einige wenige zu nennen. Und nun kommt Stuart Jeffries und geht über diese differenzierten Formen hinweg zurück zu den ältesten Kamellen. Was tun? Versuchen wir es daher selbst ein wenig mit Dialektik: Hat Jeffries denn selbst neue Perspektiven zu bieten, wenn er alte Vorurteile aufgewärmt und er im Wesentlichen den Frankfurtern angebliche Praxisferne und den Hang zum Luxuriösen vorwirft, der sich in Georg von Lukács (der selbst adelig war) Formel »Grand Hotel Abgrund« im Titel ausdrückt? Erstaunlicherweise macht gerade der Wirtschaftsliberale Jeffries sich damit zu einem Fürsprecher des radikalen Klassenkampfes. Aber kann man heute noch ernsthaft politische Organisationsfragen im Stil von Lukács stellen, wie es die Formel von den dekadenten Bewohnern des Grand Hotel Abgrund nahelegen will? Welche Organisationsform hatte Lukács denn anzubieten? Und welche die heutige real existierende Linke? Möchte Jeffries tatsächlich mit Labour und der deutschen Sozialdemokratie nach der Agenda 2010 eine Revolution machen? Der Niedergang des Proletariats und der Sozialdemokratie ist doch offensichtlich kein Hirngespinst. Und gibt es nicht umgekehrt viele Hinweise auf Lenin und Trotzki bei Horkheimer und Adorno? Stellt nicht so eine Perspektive mit einer weiteren emphatischen Frage nach Praxis und Positivität geradezu die Verhältnisse auf den Kopf? Die Frankfurter Schule war deswegen so wirkmächtig, weil sie diese Fragen eben nicht suspendierte, sondern anders formulierte auf der Grundlage einer negativen dialektischen Diagnose der Gesellschaft. Und als Re-Immigranten waren sie in Deutschland erfolgreicher als andere, wissenschaftsorganisatorisch und politisch mit dem mächtigen amerikanischen Hochkommissar und den Reeducation-Programmen im Rücken. Am wichtigsten aber aufgrund ihrer Attraktivität für die der Wüste der Nachkriegszeit nach intellektuellem Wasser darbenden Studenten. Die angedeuteten neueren Forschungen zeigen, dass nicht nur einzelne Daten neu interpretiert werden müssen, sondern insgesamt die gängige, auch von Jeffries genüsslich reproduzierte Vorurteilsstruktur von Praxis gegen Theorie, Positivität gegen Negativität, melancholische Untätigkeit versus Handeln einer gründlichen Revision unterworfen werden muss. Das bezieht sich auch auf die dramatischen Effekte, die Jeffries erzielen will, und die auf ein entsprechendes Verhältnis von Erwartung und Anlass, Figur und Grund zurückgehen. Wenn sensationeller Weise berichtet werden soll, dass Herbert Marcuse während der revolutionären Kämpfe 1919 Berlin mit einem Gewehr herumgelaufen ist, so kann das nur schockierend wirken, wenn man das Bild eines Weicheis und intellektuellen eggheads der Frankfurter Theoretiker vor Augen hat. Man kann aber auch in der Theorie ernst sein und scharf. Auch das ist ein Kampf, aber ein anderer, als Jeffries sich das in seiner Welt denkt. Herbert Marcuses Sexleben Aber die Bilder, mit deren Hilfe Jeffries die Frankfurter desavouieren will, sind selbst doppeldeutig und flackern. So sollen am Ende zwei der Versuche des camouflierten Diskurses erwähnt werden. Im Kapitel über Herbert Marcuse, dass auf das Interview Jeffries mit dessen Schülerin Angela Davis zurückgeht, wird Marcuse selbst in einer Argumentation wie »von Hinten durch die Brust ins Auge« unversehens in die Nähe von Chauvinismus, Rassismus und Sexismus gerückt: Zuhause habe er mit Vorliebe mit einem Plüschnilpferd im Sessel gesessen, während seine zweite Frau Inge ihn derweil bekocht habe – bei Jeffries schrillen anscheinend alle Alarmglocken: Vorsicht, armchair-philosopher; außerdem hatte sich auch Adorno in den Briefen an die Eltern als »Nilpferdkönig Archibald« bezeichnet. »Das Persönliche ist politisch«, weiß der Klassenkämpfer und Feminist Jeffries. Auch Marcuse gehörte also letztlich zu den Unselbständigen, deren Ausbeutung nach Angela Davis die amerikanische Gefängnisindustrie begünstigte. (»Einige der späteren Schriften und Aktivitäten von Davis könnte man als fortgesetzte Analysen interpretieren, in denen sie die faschistischen Tendenzen ihres ehemaligen Lehrers beleuchtete.« – Meint er das wirklich ernst oder handelt es sich um einen Übersetzungsfehler?) (S. 381) Darüber hinaus habe aber Marcuse mit seiner vermeintlichen sexuellen Befreiung die sogenannte Raunch-Kultur befördert, also die verdingliche Sexualisierung im Playboy und der Pornoindustrie in Amerika. Außerdem soll er seinen Stiefsohn zu terroristischen Aktionen animiert haben, will es dann aber auch nicht gewesen sein – diese wirre Argumentation kann, wer will, im 15. Kapitel (»Motherfuckers an die Wand«) nachlesen. Popstars und Attitude Die Schlussfolgerung daraus ist bei Jeffries jedenfalls, dass Marcuse ein Popstar wie Mick Jagger oder Bob Dylan gewesen sein soll, der sich im Glanze seines Narzissmus gesonnt hätte. Ein anderer Popstar der Linken aber habe ihn da genau durchschaut. Die Präsentation der Anekdote über ein Treffen Marcuses mit Jean-Paul Sartre 1968 in Paris wird folgendermaßen eingeleitet: »Trotz Marcuses radikalem Chic und seinem Ansehen in der gegenkulturellen Szene ließ sich sein Rivale um den Titel ‚Held der Neuen Linken und der Studentenbewegung‘ nicht verführen.« (S. 386). Sartre kannte danach angeblich keine einzige von Marcuses Schriften und bat daher seinen späteren Biografen John Gerassi um eine Teilnahme an diesem Treffen, der es anschließend rapportierte. Dort kaprizierten Gerassi und Sartre sich auf die Taktik, Marcuse hauptsächlich »kluge« Fragen zu stellen und ihn so abzulenken: Als es dann so weit war – es wurde Cassoulet serviert –, verfiel Sartre auf eine geniale Strategie, mit der er sein Unwissen verbarg. Er stellte Fragen, die eine größere Vertrautheit mit Marcuses Werk vermuten ließen, als er tatsächlich hatte. »Jedes Mal, wenn er antwortete, pickte ich mir eine scheinbare Schwachstelle aus seiner Antwort heraus und stellte eine weitere Frage. Da die Schwachstelle allerdings offensichtlich war, konnte er meine Frage zu seiner größten Zufriedenheit beantworten. Und so segelte er in seiner Selbstgefälligkeit glücklich dahin.« Das war tatsächlich so: Gerassi brachte Marcuse zum Taxi und Marcuse »schüttelte mir beide Hände mit echter Dankbarkeit und sagte: ‚Ich hatte ja keine Ahnung, dass er mein Werk so gut kennt.‘«[8] So werden eitle Fatzke erst mit feinem Essen abgespeist, um dann gründlich hereingelegt zu werden. Es scheint ein genialer Schachzug Sartres in einer Szene wie in Boccaccios Decamerone gewesen zu sein, mit dem auch Stuart »der Fuchs« Jeffries sich anscheinend gerne identifiziert. Jeffries ist ein großer Anhänger von James Bond, Ian Flemming und dem Spion Richard Sorge! (S. 102) Ja, das war mal ein Mann und keine Memme! Aber diese Geschichte bleibt hintersinnig, wenn man sie auf Jeffries eigene Studie anwendet. Es könnte nämlich herauskommen, dass nicht nur Sartre keine Ahnung von Marcuses Schriften gehabt hat, sondern dass das Ganze auch auf Jeffries selbst zutrifft: Nicht nur hat er offensichtlich Marcuse nicht wirklich gelesen, sondern auch die Schriften von Adorno und Horkheimer, wenn überhaupt, nur sehr oberflächlich angesehen. Trotzdem hat es anscheinend bislang keiner gemerkt und viele Kritiker sind sogar der Meinung, es handele sich tatsächlich bei diesem Buch um ein Buch zur Verteidigung der die Kritische Theorie. In Wirklichkeit aber geht es offensichtlich um genau das Gegenteil: Vorzuspielen, man beschäftige sich mit einem Gegenstand. Sartre – über dessen Sexleben, wie über das von Heidegger oder auch von Russell wir hier lieber nicht sprechen wollen – hatte neben dem wohl unausgesprochene Grund, dass Marcuse ihn 1948 der geschichtslosen Anhängerschaft Heideggers gezeiht hatte, dafür angegeben, nicht auch noch die Texte von Marcuse lesen zu müssen, dass er an seiner Flaubert-Biografie Der Idiot der Familie arbeitete. Und von Flaubert wissen wir, dass er in seinem Roman Bouvard und Pécuchet genau das vorgemacht hat: Wie man sich auf einer scheingelehrten Oberfläche lieblos mit Gegenständen beschäftigt, ohne eine Ahnung davon zu haben, worum es darin wirklich geht. Mach’s gut und danke für den Fisch Das letzte Kapitel in Jeffries Buch ist dann ein Nachklapp des vorletzten euphorischen über Habermas. Hingewiesen wird auf Axel Honneth, der seine intellektuelle Tätigkeit um den Anerkennungsbegriff kreisen lässt. Von anderen Ausprägungen der kritischen Theorie als der Habermas-Linie findet sich (außer kleinen Hinweisen auf Fred Jameson und Martin Jay der aber dann eigentlich von Adorno reingelegt wird, S. 394) keine Spur. Dass die kritische Theorie sich so verbreiten könnte, wie Jacques Tatis Figur Monsieur Hulot in dessen letzten Film Playtime – sich nämlich zu vervielfachen – wird nicht reflektiert. Dafür ist die Rede vom Abgesang auf die Kultur angesichts des Internets und der Digitalisierung. Angeblich sagten die Texte der kritischen Theorie einem nichts mehr, dann aber sollen sie doch wieder gelesen hatten. (S. 464) Immerhin führt Jeffries hier ein letztes erhellendes Bild mit eigener Dialektik an, dass ein Schlaglicht auf sein ganzes Buch wirft. Er zitiert die Figur »Chip Lambert« aus Jonathan Franzen Roman Die Korrekturen. Lambert verkauft im Roman Anfang der Neunzigerjahre seine angesammelte Bibliothek der Frankfurter Theorie, die ihn einmal 4000 $ gekostet hatte und erhält dafür nun nur noch 65 $. Diese investierte der frisch gebackene Hedonist dann in einem Feinkostladen in einen geräucherten norwegischen Wildlachs. Mit seinem Konsumismus will er seine neue Freundin beeindrucken. Auch diese Geschichte lässt sich zwanglos weiterdenken. Denn man hat nun allerdings den Eindruck, dass es Jeffries war, der im Antiquariat Lamberts Bibliothek erstanden und sie nicht wirklich gelesen hat. Er liest sie auch nicht nach ihrem ideellen Wert, sondern beurteilt sie exakt nach diesen 65 $, die er dafür gegeben hat. So kann man sich dann auch guten Gewissens seines eigenen Buches, mit dem er den Ausbeutungszyklus der Frankfurter Schule um einen Grad weitergedreht hat, entledigen und es gleich ins Antiquariat bringen – allein schon wegen des lieblosen Covers. Mit einem Rekurs auf den Titel des vierten Bandes von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis kann man ihm einen letzten Gruß hinterhersenden: »Mach's gut und danke für den Fisch.«
[1] S. 167.
[2] S. 18.
[3] S. 15.
[4] GS 1, S. 318.
[5] S. 203.
[7] »Die hoffnungsvolle Richtung, die Habermas für die
deutsche Philosophie vorgab, wirkte wie eine rebellische
Antwort auf Adornos philosophische Verzweiflung. Adornos
negative Dialektik war eine Art von Denken, das jegliche
Methode verschmähte und sich der Schaffung eines
systematisch theoretisierten, rational erzielten Konsenses
verweigerte, der hingegen die Leitvorstellung des
habermasschen Denkens bildete. Dabei geht es nicht nur um
ödipale Rebellion. Entscheidend ist außerdem der Umstand,
dass Habermas kein Jude ist.« (S. 424).
[8] S. 386.
Artikel online seit 29.11.19 |
Stuart Jeffries |
|
|
|
||