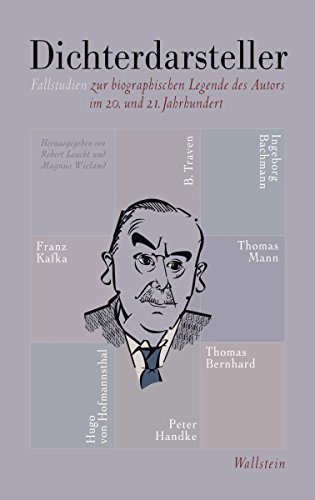|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
|
Biographische Legenden Von Lothar Struck
|
||
|
Seit Roland Barthes in den 1960er Jahren den "Tod des Autors" verkündete, galt es lange Zeit in den Literaturwissenschaften als verpönt, Werk und Vita des Autors in Zusammenhang zu bringen. Erst in den letzten Jahren wurde dieses nahezu wie ein Tabu behandelte Diktum aufgegeben und wieder vermehrt die Frage nach Interdependenzen zwischen dem Leben eines Autors und dessen Werk gestellt. Die Enthüllung um das Pseudonym von Elena Ferrante zeigen, wie wichtig es inzwischen zu sein scheint, ein Werk direkt mit der Autorin zu verknüpfen. Insofern überrascht es, dass im Feuilleton die Demaskierung bisher mehrheitlich abgelehnt wird. Robert Leucht und Magnus Wieland, die Herausgeber des im Frühjahr erschienenen Buches "Dichterdarsteller - Fallstudien zur biographischen Legende des Autors im 20. und 21. Jahrhundert", erklären diese Tendenz vor allem aufgrund der steigenden Bedeutung der sozialen Medien, in denen Personalisierungseffekte forciert werden. Parallel ist allerdings seit geraumer Zeit ein starker Hang zum biographistischen Lesen im deutschsprachigen Feuilleton zu erkennen. Leucht und Wieland nehmen sich mit ihrem aktuell herausgegebenen Band dem ewigen Widerstreit zwischen biographistischer und puristischer, ausschließlich auf den jeweiligen Text konzentrierter Lesart, an und machen mit der Wiederentdeckung der "biographischen Legende" einen Versuch, die beiden literaturwissenschaftlichen Lager zu versöhnen. Die "biographische Legende" ist ein Begriff des russischen Literaturwissenschaftlers Boris Tomaševskij aus dem Jahr 1923. Die beiden Herausgeber des Buches stellen diese lange vergessene These in einer detailreichen Einleitung vor. Die biographische Legende wird dabei als Abgrenzung zum empirischen Autor als Konstruktion hin zum Werk interpretiert und aber auch distanzierend zur Autorenfigur des literarischen Textes betrachtet. Sie ist somit eine dritte auktoriale Instanz; sozusagen "zwischen" der realen Vita des Autors und dessen Werk. Dass das reale Leben die Prosa eines Autors mindestens beeinflusst wenn nicht gar bestimmt ist der Kern der biographistischen Interpretation. Aber auch die im literarischen Kunstwerk aufscheinenden, fiktiven Bezüge erzeugen im "realen Leben" Rückkopplungen. In der biographischen Legende verschmelzen nun biographische Aspekte im Werk und Werkaspekte im Leben zu einer neuen ästhetischen Figuration. Sie basiert darauf, "im Leben epische Momente zu inszenieren und sich andererseits eine künstliche biographische Legende mit einer bewussten Zusammenstellung realer und erdachter Ereignisse zu schaffen". Damit ist nicht eine aus kommerziellen Erwägungen heraus betriebene Selbstvermarkung und/oder –inszenierung durch den Autor (bzw. Verlag oder PR-Agentur) gemeint. Die Herausgeber weisen am Ende des Buches darauf hin, dass die biographische Legende gerade nicht reduziert werden kann auf "Pose, Marke, Image, Inszenierung oder Habitus". Nach Tomaševskij ist es allerdings im Einzelfall "schwierig zu entscheiden, ob die Literatur diese oder jene Lebenserscheinung reproduziert oder ob umgekehrt diese Lebenserscheinungen das Resultat des Eindringens literarischer Schablonen in das Leben ist". Diese Grenzen sind amorph und hier wäre dann das Feld für die Arbeit des Literaturwissenschaftlers bestellt. In den Fallstudien im Buch soll es nicht darum gehen "biografische Spuren im Werk eines Autors nachweisen zu wollen, sondern darum, die literarischen Verfahren bei der Evokation einer öffentlichen Autorenfigur und deren Bedeutung mit Blick auf das literarische Werk zu beschreiben" (im Buch wird nur bei der "biographischen Legende" das "ph" benutzt, ansonsten wird die vom Duden empfohlene Schreibweise mit "f" verwendet). Dieses vorgegebene Ideal würde sich von den zum Teil plumpen Entlarvungsstrategien der jüngeren wissenschaftlichen Literatur wie beispielsweise Carolin John-Wenndorfs "Der öffentliche Autor", die sich im Kern mit drei Gegenwartsautoren (Grass, Handke, Jelinek) beschäftigte und jede öffentliche Erscheinungsform dieser Autoren als (kommerziell motivierte) Inszenierungsstrategie interpretierte, wohltuend unterscheiden. Leider klafft zwischen dem Anspruch und einigen der Studien dann doch zuweilen eine größere Kluft. So in Katrin Bedenigs Text über "Thomas Mann als Dichterdarsteller", in dem sie zwar Erhellendes zur Adaption des Thomas-Mann-Habitus bei Daniel Kehlmann beiträgt, sich dann jedoch allzu sehr in Schilderungen von Manns Gastfreundschaft verliert, die ihr als besonders ausgeklügelte Vermarktungsstrategie erscheint. Gern habe der Dichter seinen gar nicht so sakrosankten Tagesablauf aufgegeben, wenn ein Gespräch mit einem wichtigen Journalisten angestanden habe. Schließlich wird eine Postkarte gedeutet, auf der man Thomas Mann als Familienvater sehen kann. Er habe, so heißt es, eine "ausgeprägte mediale Begabung" besessen – ein Tatbestand, der nicht vollkommen unbekannt war allerdings nicht direkt das Thema des Bandes berührt. An Franz M. Eybls Essay über "Thomas Bernhards poetologische Maskeraden" kann man erkennen, wie schwierig das Erfassen einer biographischen Legende im Sinne von Tomaševskij sein kann. Eybl attestiert Bernhard ein "virtuoses Maskenspiel", eine "Osmose zwischen Autobiografie und literarischem Werk". Aber wenn die als "autobiographisch" deklarierten Schriften fiktionale, erfundene Elemente enthalten oder, wie Eybl nachweist, der sogenannte "Staatspreisskandal" von 1968 in mehreren Versionen von Bernhard in Erzählungen, Briefen und auch Interview-Äußerungen verbreitet wird, dann ist es irgendwann nahezu unmöglich, Selbststilisierung von biographischer Legende zu unterscheiden. Dabei könnte dies natürlich genau das Ziel von Bernhard gewesen sein. Welche Rolle dabei die außerliterarischen Bezüge und hier vor allem die Fernsehinterviews von Bernhard (insbesondere die Filme von Krista Fleischmann) gespielt haben, kommt leider zu kurz. Auch bei Franz Kafka, einem Autor, der zu Lebzeiten praktisch unbekannt war, stellen sich fast erwartungsgemäß Schwierigkeiten ein, da die biographischen Ereignisse des Prager Schriftstellers aus Briefen, Tagebüchern und Zeugnissen von Zeitgenossen mit seinem Werk zusammengebracht werden, was meist zu einer mehr oder weniger starken biographistischen Lesart führt (es sei denn, man interpretiert die Tagebücher als Versuche der Legendenerzeugung). Daher überrascht es sehr, dass Ulrich Stadler in seinem Text die "Autor-Legende" bei Kafka für stark ausgeprägt hält. Einen schlagenden Beweis hierfür bleibt er weitgehend schuldig, zumal er den Effekt des "Kafkaesken" schlüssig als Erlebnis beim Lesenden verortet und weniger als Autorstrategie. Auch sind die Interpretationen zu den letzten Sätzen des "Proceß"-Romans anregend, aber der Bogen zur biographischen Legende, die ja eine dritte auktoriale Instanz zwischen Figurenleben und realer Biographie sein soll, gelingt weniger, es sei denn, man liest den Mord an K. als eine Art Selbstbestrafung des Autors, was dann wieder eine eher biographistische Lesart wäre. Thematisch ergiebiger ist Anna-Katharina Gisbertz' Text zu Hugo von Hofmannsthal, dem "lesenden Dichter", der sein "weltliches Gewebe" mit mehr als 11000 Briefen knüpft und schon in seinen jungen Jahren "legendär" wirkt. Interessant ist der Beitrag, wenn auf Hofmannsthals (gescheiterte) Versuche eingegangen wird, sich zu Stefan George zu positionieren. Karl Wagner versucht erst gar nicht, die biographische Legende Peter Handkes zu entwickeln sondern konzentriert sich auf dessen Auftritt bei der Gruppe 47 in Princeton 1966, der dauerhaft einer der Meilensteine in der Dichterbiographie wurde. Wagner vergleicht dabei die Dichterauftritte der 1960er Jahre beispielsweise von Alan Ginsberg und Ernst Jandl 1965 in der Royal Albert Hall in London vor Tausenden von Zuhörern und rückt damit die Dimension des "Auftritts" (das Wort wird von ihm von nun an in Anführungszeichen gesetzt) zurecht. Damit erscheint die Intervention Handkes bei der Gruppe 47 geradezu "schüchtern". Detailliert wird die Frage untersucht, inwieweit es sich um eine Inszenierung Handkes handelte (was dieser bis heute bestreitet). Wagner plädiert für einen Kompromiss und erkennt eine Mischung von Kalkül, Planung und Eingebung. Dass die Medien weniger am Inhalt von Handkes Rede interessiert waren als am Skandalon des Jungstars, der gegen die Altvorderen unorthodox rebelliert hatte, zeigt sich unter anderem darin, dass es immerhin 23 Jahre dauerte bis der volle Wortlaut der "Intervention" (Wagner) erschien. Vorher wurden nur bestimmte Reizvokabeln wie "Beschreibungsimpotenz" oder "läppisch" weitergegeben; die Intentionen Handkes blieben zweitrangig. Wagner hat zum Schluss noch eine Pointe bereit: Handkes Rede in Princeton, diese "Inszenierung von Autorschaft", ereignete sich fast parallel zum Erscheinen von Roland Barthes "Tod eines Autors" 1966 in englischer Sprache. Sehr instruktiv ist Evelyne Polt-Heinzls Essay über "Modellierungsoptionen für Dichterinnen". Der Bogen, den Polt-Heinzl spannt, ist groß; er reicht von Bettina von Arnim, Helene von Druskowitz, 1856 geboren, die damals kaum ein würdiges Leben als "alleinstehende, ökonomisch schlecht abgesicherte Intellektuelle" führen konnte, in den 1890er Jahren psychisch zusammenbrach und von da an bis zu ihrem Tod 1918 in Irrenhäusern verbrachte, über Vicky Baum, Else Lasker-Schüler, Ilse Aichinger bis Ingeborg Bachmann. Allen gemein ist, so die These, die fremdbestimmte "role model" Zuweisung als Frau, welche die Dichterinnen gar nicht oder nur sehr schwer abstreifen konnten und die biographischen Legenden sozusagen zwangsweise grundierte. Jan-Christoph Hauschild beschäftigt sich mit dem Biografieboykotteur B. Traven, der mit erfundenem Lebenslauf und ausgedachten Anekdoten seine Abenteuergeschichten beglaubigte und den in den 1920er und 1930er Jahren virulenten Authentizitätswahn perfekt bediente. Dabei war nicht einmal sein Verleger war darüber informiert, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg. In einem sehr anregenden Text erläutert Hauschild den im Laufe der Zeit stetig wachsenden Fluch der Selbstinszenierung von B. Traven - sowohl dem literarischen Betrieb gegenüber als auch die immer schwieriger werdenden Anforderungen, den Erwartungen seines Publikums gerecht zu werden. Die Anonymität war Mittel zum Zweck. Ansonsten wäre die Aura des Abenteurers vernichtet und die Texte sozusagen entwertet gewesen. Aber inwiefern lässt sich die biografische Legende auch in den sozialen Medien des digitalen Zeitalters anwenden? Hanjo Berressem untersucht dies am Medium Twitter und dessen "Gebrauch" von amerikanischen Autoren wie vor allem Bret Easton Ellis (aber auch von Mark Z. Danielewski, Chuck Palahniuk und Lindsay Lohan). Ellis' Gebrauch des Mediums ist laut Berressem stark impulsiv gesteuert, d. h. der Autor ist durchaus mit provokativen, auch politisch unkorrekten Tweets aufgefallen. Berressem sieht diese verlorene Affektkontrolle als immanent für das Medium selber an. Eine "medienadäquate" Benutzung vertrage sich nicht damit, kontemplativ und "reflektiert zu agieren". Er verfällt schließlich sogar in den alarmistischen Duktus, dass das Medium den User benutze und nicht umgekehrt. So wird Twitter zu einer anarchischen Spielwiese, in der die Akteure scheinbar in eine unkontrollierte "écriture automatique" verfallen, die am Ende ungewollt "das wahre Gesicht" des Benutzers (hier: Bret Easton Ellis) zeigt. Im Buch finden sich einige Tweets von Ellis aus den Jahren 2012 und 2013, die als Entgleisungen und Invektiven auf real existierende Personen bewertet werden. Sie fungieren als Beleg für die These, dass das "auktoriale Kalkül" des Autors auf Twitter verloren geht. Ein Blick auf den <a href="https://twitter.com/BretEastonEllis">aktuellen Account von Ellis zeigt</a>, dass diese Sicht übertrieben ist. Per 09.10.2016 finden sich dort 2416 Tweets. Beigetreten ist er laut Twitter im April 2009. In etwas mehr als siebeneinhalb Jahren macht dies im Durchschnitt weniger als einen Tweet pro Tag aus. Von einer exzessiven Nutzung kann also keine Rede sein. Aktuell sind die meisten Tweets Hinweise auf die von <a href="http://podcastone.com/Bret-Easton-Ellis-Podcast">Ellis produzierten Audiopodcasts</a>, die meist 14tätig erscheinen und auf seiner Seite kostenlos zugängig und sogar herunterladbar sind oder Meldungen, welche Filme oder Serien er gerade angeschaut hat. Tatsächlich scheint Ellis auf die emotional-impulsiven Tweets inzwischen weitgehend zu verzichten. Im Rahmen der biographischen Legende kommt Berressem zu dem Resultat, dass der Versuch einer die Legendenbildung in einem Medium wie Twitter scheitern muss. "Manierismus und Inszenierung" würden schnell als Attitüde entlarvt. Ein bisschen scharwenzelt er um den heißen Brei der Authentizität herum. Im Grunde läuft Berressems Fazit jedoch darauf hinaus, dass Verstellungen im Netz nicht mehr möglich sind. Aber wie steht es dann mit dem Satz "Tweets sind Ausdruck eines Lebens, nicht seine Darstellung"? Sind Tweets stets "rein" und ohne Kalkül? Vielleicht verführen ja Facebook und Twitter zu quasi-authentischen, affektierten (Re-)Aktionen, aber diese können ebenso wohl kalkuliert und inszeniert sein wie ein Auftritt. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Richtig ist, dass das Netz Vermarktungsstrategien von Autoren befördern kann. Für diese Einsicht genügt es, den User nicht als willenloses Objekt der Maschine zu betrachten. Der letzte Beitrag dieses Bandes ist von Christoph Steier und trägt den merkwürdigen Titel "Staatsfernsehen". Erst der Untertitel gibt nähere Auskünfte: "Ästhetik und Funktion des Klagenfurter Autorenporträts im 21. Jahrhundert." Steier hat – so scheint es - den Stein der Weisen gefunden, die "biobibliographische Formel" mit der zuverlässig der Sieger des Bachmannpreises in Klagenfurt vorhergesagt und eben auch "gemacht" werden kann. Die "bipolare Gretchenfrage" der "Großnarrative" zwischen Leben und Werk wurde von ihm dahingehend beantwortet, dass in Klagenfurt eine spezifische, sich im Autorenportait (vulgo Video) zeigende "Autor-Text-Figuration", die "selber eine Geschichte erzählen" muss, Preise bzw. den Hauptpreis erhält. Die Hauptpreisvergabe der letzten 14 Jahre basiere mehrheitlich auf "dem im jeweiligen Video präfigurierten Moment der Konversion, die im 'Bewerb' als Initiation vollzogen wird". Ausgezeichnet würden "nicht Texte, sondern Autoren, deren Legende die Institutionen in Klagenfurt in zunehmender Oligarchie selbst zu produzieren unternimmt." Der Wettbewerb in Klagenfurt muss, so die These, den Autor als an einem Übergang stehend zeigen. Der Preis fungiert dann als "nachträgliche Anerkennung eines bisher am Markt vorbei produzierten Oeuvres", das symbolische Kapital werde nun entsprechend verzinst. Es findet eine Belohnung statt. Die zweite Möglichkeit ist die "Anerkennung eines eingeschlagenen neuen Weges". In diesem Fall ist der Teilnehmer nicht gänzlich publizistisch unbekannt ("Einen Sieger aus dem völligen publizistischen Nichts gibt es in Klagenfurt nicht"), hat aber kein größeres Werk zu bieten, das "belohnt" werden könnte. Mit der Lesung findet so etwas wie eine Konversion statt; Klagenfurt wird damit zur Aufnahmestelle für in den "Literaturbetrieb Übergetretene" (Leucht/Wieland). Folgt man Steiers Ausführungen besteht die Aufgabe des Autors darin, seine Autorendarstellung im Video durch den Text zu beglaubigen. Dabei ist zu beachten, dass die Übereinstimmungen nicht zu offensichtlich sein sollten; eine gewisse Überraschung sollte es doch noch geben, was in der schönen Formel einer "Kombination von Neuheit und Redundanz" mündet. Fehlt der Faktor "Neuheit" so scheitert die Preisvergabe, wie an Beispielen ausgeführt wird. So ganz überflüssig ist der Text also doch nicht. "Wenn…weder die Bestätigung noch die zaghafte Verschiebung der bestehenden biographischen Legende" sich hinreichend im Text zeigt, so fällt dieser bei den Juroren nicht literarisch-ästhetisch durch (die Lobe gäbe es trotzdem), aber es gibt keinen Preis. Das gleiche gelte für zu perfekte Texte oder auch für zu bekannte AutorInnen. Die Liste, die Steier aufführt, ist imposant. Eine gewisse argumentative Geschmeidigkeit des Autors zeigt sich in der Auslegung der These im Fall von Tex Rubinowitz, dem Bachmannpreisträger von 2014, der ohne ein Videoportrait den Preis gewonnen hatte. Hier greift, so die Erklärung, das Konversionsmotiv in Kombination mit einem besonders hohen Bekanntheitsgrad in einem anderen künstlerischen Bereich (in diesem Fall als Cartoonist und Zeichner). In Steiers Klagenfurt-Formel spiegelt sich eine Sehnsucht nach der Abschaffung literaturwissenschaftlicher Analyse durch Empirie. Wie schon in der "Automatischen Literaturkritik" werden fast ausnahmslos außerliterarische bzw. außerwissenschaftliche Kriterien bemüht, um die Güte und Preiswürdigkeit eines Textes positivistisch zu bestimmen. Der Traum so manches Klagenfurt-Groupies ist erfüllt: Das After-Show-Programm kann nach dem Zählen der Punkte sofort beginnen. Es winkt (oder droht?) der unendliche Spaß. Oder doch eher die unendliche Langeweile? Mit biographischer Legende im Sinne Tomaševskijs hat das nichts mehr zu tun, was wieder zu passen scheint, denn die Literatur ist in diesen knallhart durchgezogenen Inszenierungen allzuoft nur noch in homöopathischen Dosen vorhanden. Der Rest ist Show. Wenn auch der leicht pejorative Titel "Dichterdarstellung" etwas befremdet und einige Aufsätze die Thematik zeitweise aus den Augen verlieren, ist der Band eine empfehlenswerte Lektüre. Vielleicht hätte man statt die üblichen Verdächtigen heranzuziehen, andere, weniger bekannte (und auch weniger spektakuläre) Autoren untersuchen sollen. Welches osmotische Verhältnis zwischen Werk und Autor zeigt sich beispielsweise in den Romanen von Hermann Lenz? Welche Rollenerwartungen werden bei Josef Winkler in seinen "Ackermann"-Romanen geweckt? Und wie korrelieren Lebens und Werk bei Andreas Maier und seinen Wetterau-Romanen? Interessant wäre es auch gewesen am Fall von Binjamin Wilkomirski die psychopathologischen Deformationen von biographischen Legendenbildungen herauszuarbeiten. Aber man muss wohl einsehen, dass Kafka, Thomas Mann und Thomas Bernhard mehr Leser generieren. Zwei
Punkte irritieren allerdings: Der Text von Boris Tomaševskij, der 2000 in einem
von Fotis
Jannidis mitherausgegebenen Band neu publiziert wurde, umfasst nach Angaben
der Verfasser nur rund 12 Seiten. Warum wurde dieser Text nicht mindestens in
seinen Kernpunkten abgedruckt? Stattdessen muss der Leser sich Details aus den
Zitaten zusammensuchen. Dabei finden sich zwei essentielle Stellen von
Tomaševskijs These nicht in der Einleitung, sondern in anderen Aufsätzen (Seite
84 und Seite 192). Die zweite Irritation: Es geht um biographische Legenden und
Autor-Werk-Konfigurationen in diesem Buch – aber man vermisst jeden
biographischen Hinweis auf die Herausgeber und Autoren der Fallstudien. Ein
besonderer Humor, der sich mir allerdings nicht erschließt.
|
Robert Leucht
und Magnus Wieland |
||
|
|
|||