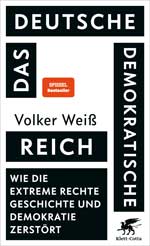|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
|||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
|||
|
|
|||
|
Politische
Begriffsverwirrung und Palimpsest Von Wolfgang Bock |
|||
|
Der Historiker und
Kenner des deutschen Rechtsradikalismus Volker Weiß beschäftigt sich in seinem
neuen Buch mit einem irritierenden Phänomen: der Überschreibung linker
kritischer Narrative durch die rechten Bewegungen. Er geht den Windungen der
Diskurse in aktuellen politischen Debatten nach. Die herrschenden Politiker machen es ihm
einfach, diese rhetorischen Figuren der Synekdoche, bei der ein Teil für das
Ganze steht, und der Katachrese, bei der das Verhältnis von Zeichen und
Bedeutung ruiniert wird, nachzuweisen. Donald Trump reckt nach den Schüssen auf
ihn wie ein Arbeiterführer oder Anhänger der Black Panther die Faust in die
Höhe, Wladimir Putin spricht von der Demokratiebewegung in der Ukraine als Nazis
oder G.D. Vance und Alice Weidel – letztere lesbisch und Chefin der
queerfeindlichen AfD – wollen Hitler und Goebbels als Kommunisten
identifizieren. Sprach- und Sinnverwirrung also allenthalben.
»Zeichen müssen sich
verwirren, wo sich die Dinge verwickeln.« Das schreibt Walter
Benjamin in seiner ersten Sprachtheorie von 1917.[1] Schmitt war Kronjurist des Dritten Reichs und bekam nach 1945 Berufsverbot, aber sein Arm und sein Schatten reichen noch weit in die politische Landschaft der Bundesrepublik hinein. Götz Kubitschek aus Schnellroda lässt Schmitts Texte zur Bekämpfung der Demokratie aus den zwanziger Jahren aktuell ins Internet einstellen. Schmitt ist einer der intelligentesten Rechten, der von Anfang an auf diese Art von Begriffsverwirrung als gezieltes politisches Mittel gesetzt hat. Und so will auch Volker Weiß für seine These der Disruption der politischen Begriffe nicht nur Steward Hall und Judith Butler anführen. Deren dekonstruktivistische Methoden weisen in ihren Theorien des Postkolonialismus und des Genderkampfes Ähnlichkeiten mit dem Umwidmungsverfahren der neuen Rechten auf. Sondern an zentralen Stellen verweist Weiß auf den Bielefelder Historiker Reinhart Koselleck und sein Projekt der Untersuchung des sprachgeschichtlichen Wandels historische Begriffe.[4] Dabei verkennt Weiß, dass es gerade der Schmitt-Schüler Koselleck ist, der noch stärker als Böckenförde das Erbe der Schmitt’schen Rabulistik in dem Diskurs über die Geschichte in der Bundesrepublik bewahrt. Kosellecks Initiationserlebnis war es, als deutscher Frontsoldat, von den Russen in dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz inhaftiert worden zu sein. Bis zu seinem Tod 2006 leugnete Koselleck die Realität des NS-Lagers Auschwitz und lebte von dessen Überschreibung mit dem, was er selbst als russischer Kriegsgefangener erlebt hatte. Daraus leitet er eine Minderwertigkeit der historischen Begriffe und eine Höherwertigkeit des eigenen Erlebens ab. Koselleck ist gleichsam der moderne Urvater des Palimpsests und der Umdeutung historischer Begriffe in der Bundesrepublik. Bereits seine viel gelesene Doktorarbeit Kritik und Krise von 1954 will die Französische Revolution als Ursache der Krise der Moderne ansehen, und nicht als eine freilich aus dem Ruder laufende Reaktion auf das Ende des Feudalismus.[3] Und so ist auch Kosellecks Lexikonprojekt der Begriffsgeschichte, welches Weiß zur Unterstützung seiner These heranziehen möchte, durch und durch tingiert von dem Phänomen, das Weiß mit Recht anprangert. Hinter die Aufklärung sollte man nicht zurückfallen. Schon der Hamburger Kunsthistoriker Abby Warburg wusste, dass Athen immer wieder aus Alexandrien zurückerobert werden muss.
[1] Walter
Benjamin, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen,
Gesammelte Schriften Bd. II, S. 156.
[2]
Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Die Entstehung des
Staates als Vorgang der Säkularisation«, in: Säkularisation und
Utopie. Ebracher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag.
Stuttgart: Kohlhammer 1967, S. 75–94. Vgl. vom Verfasser:
Gewaltkritik. Politik, Populismus und Parlamentarismus bei Walter
Benjamin, Carl Schmitt, Georges Sorel und Giorgio Agamben, Würzburg:
K&N 2021, S. 49.
[3]
Vgl.
https://www.glanzundelend.de/Red23/J-L/reinhart_koselleck_krise_und_kritik.htm
[4] Vgl. Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006
Artikel online seit 21.06.25 |
Volker Weiß |
||
|
|
|||