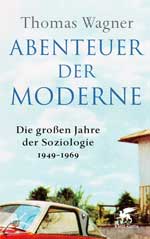|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
|||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
|||
|
|
|||
|
Eine Art akademischer Abenteuerroman |
|||
|
Thomas Wagner rückt zwei Antipoden ins Zentrum seiner Darstellung der deutschen Soziologie in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf der einen Seite ist dies der 1904 in Leipzig geborene Arnold Gehlen, der neben Max Scheler und Helmuth Plessner zu den Hauptvertretern der Philosophischen Anthropologie zählt. Auf der anderen Seite ist dies Theodor W. Adorno, 1903 in Frankfurt geboren und einer der wichtigsten Denker der so genannten Frankfurter Schule, die eine auf Hegel, Marx und Freud aufruhende kritische Gesellschaftstheorie entwickelte.
Gehlen war Mitglied der NSDAP sowie des NS-Dozentenbundes und unterzeichnete
1933 das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler. Seine Nähe zum
Nationalsozialismus war unbestritten. Wissenschaftlich verfolgte er eine
soziologische Institutionentheorie und eine antimetaphysische Anthropologie mit
empirischen Einschlägen. In „Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der
Welt“ (1940) hebt Gehlen insbesondere die kulturellen Leistungen des Menschen
hervor, die dieser als „Mängelwesen“ entwickelt habe, um in der Welt überleben
zu können. Diese Idee setzt er in „Urmensch und Spätkultur“ (1956) fort: Der
Mensch als instinktarmes, weltoffenes und lernfähiges Wesen macht seine eigene
Geschichte, die immer wieder bestimmte Kulturschwellen überschritten und zu
neuen Bewusstseinsstrukturen geführt habe. In der Folge sei nicht zuletzt die
Natur des Menschen ebenfalls immer wieder einem Wandel unterworfen. Adorno hingegen, der jüdische Wurzeln hatte, emigrierte während des NS in die USA und entwickelte nach dem Zweiten Weltkrieg, zurück in Deutschland, gemeinsam mit Max Horkheimer die Kritische Theorie, die Kapitalis- und Zivilisationskritik mit einer radikalen Vernunftkritik des aufklärerischen Denkens verband. In der mit Horkheimer verfassten „Dialektik der Aufklärung“ (1947) geht es um eine Vernunft („Aufklärung“), die Opfer ihrer eigenen Herrschaftsansprüche über die Natur gerade in einer Zeit der wissenschaftlich-technischen Innovationen geworden ist. Ein Kapitel ist zudem der „Kulturindustrie“ gewidmet, in dem von der „Aufklärung als Massenbetrug“ die Rede ist. Gemeint ist der Warencharakter der Kultur, in dem an die Stelle ästhetischer rein ökonomische Werte treten, die den Menschen zusehends manipulierten. Das spätkapitalistische Individuum erschöpfe sich in der Rolle des Konsumenten und werde von der Kulturindustrie mit trivialen und inhaltsleeren Botschaften torpediert. Adornos „Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben“ (1951) ist sodann eine Sammlung von Texten und Miszellen, die das Leben als ein entfremdetes, dem Konsum anheimgefallenes nachzeichnet. Der Versuch, diesen Beschädigungen nachzuspüren, ist für ihn der einzige Ausweg, um aufzuzeigen, wie ein unbeschädigtes Leben aussehen könnte. Auf dem Boden dieser akademischen Welten entwickelt Wagner nun eine Geschichte der Friktionen und Auseinandersetzungen zwischen den beiden Protagonisten, die unterschiedlicher kaum sein könnten, wissenschaftlich aber so sehr miteinander verstrickt sind, dass sie auch nicht recht voneinander loskommen können. Hierbei spielen zwei Sekundanten Gehlens ebenfalls eine prominente Rolle: der Philosoph und Journalist Wolfgang Harich, der politisch eigentlich recht wenig mit Gehlen gemeinsam hat und dennoch ein begeisterter Anhänger seiner Lehren wird, und der Soziologe Helmut Schelsky, der ebenfalls mit dem NS sympathisierte. Seine „Soziologie der deutschen Jugend“ mit dem Haupttitel „Die skeptische Generation“ (1957) sollte zum Stichwortgeber einer ganzen Epoche werden. Im Fokus der Studie standen westdeutsche Jugendliche des Nachkriegsjahrzehnts. Schelsky unternahm den Versuch, ein Gesamtbild der deutschen Jugend zu entwerfen und analysierte die berufstätigen Jugendlichen zwischen 14 und 25 mittels Meinungsumfragen und Einzeluntersuchungen. Im Zentrum stand die Frage nach der sozialen Rolle der Jugend in der Gesellschaft der Nachkriegszeit.
Wagner schafft
es, die unterschiedlichen inhaltlichen wie persönlichen Debatten lebhaft
nachzuzeichnen, sie in den historischen Kontext einzuordnen und das Netzwerk der
deutschen Soziologie (resp. auch der Philosophie) mit all ihren Kontroversen,
Dissonanzen und Vorurteilen zwischen 1949 und 1969 offenzulegen. |
Thomas Wagner |
||
|
|
|||