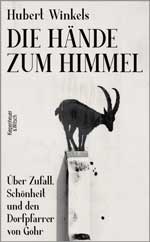|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
|||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
|||
|
|
|||
|
|
Rheinisches Hochgefühl und katholischer Zufall Hubert Winkels zwischen Romantik und Reconquista
Von Lothar Struck |
||
|
Niemand, der sich für zeitgenössische deutschsprachige Literatur interessiert, kam am in diesem Jahr 70 Jahre alt werdenden Hubert Winkels vorbei. Er schrieb nicht nur für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften Kritiken und Essays (vom Düsseldorfer Stadtmagazin Überblick über Tempo, stern, ZEIT, Süddeutsche Zeitung und Spiegel), sondern war mehr als 25 Jahre im Literaturressort des Deutschlandfunks tätig. In nahezu allen relevanten Jurys fand man seinen Namen. Breite Wirkung erreichte er durch die Tätigkeit als Juror im Ingeborg-Bachmann-Preis; von 2015 bis 2020 war er der Jury-Vorsitzende. Es sind zwei Ereignisse, die mich über alle bisweilen deutlichen Schwierigkeiten, die ich mit Winkels' Kritiken hatte, mit ihm nicht nur verbanden, sondern in denen ich ihn mit gefasster Sympathie betrachtete (ich kenne ihn nicht persönlich). Zum einen Mitte/Ende der 1990er Jahre, als er für eine kurze Zeit im Dritten Programm des damaligen den Dichterclub moderierte. Die Sendung orientierte sich, wenn ich richtig erinnere, an die SWR-Bestenliste, die einst von Jürgen Lodemann als Gegenpol zu den Bestsellerlisten mitinitiiert wurde. Hier vergeben eingeladene Kritiker (fast) monatlich Punkte für (zumeist deutschsprachige) Neuerscheinungen nach ihren persönlichen ästhetischen Literaturkriterien. So entsteht eine Rangfolge der zehn »besten« Bücher. Zum großen Teil kommen Bücher auf diese Liste, die auf den gängigen Verkaufslisten nicht zu finden sind.
Winkels fungierte beim Dichterclub als mitmachender Moderator. Eine
Redaktion suchte aus der Bestenliste vielleicht drei oder vier Bücher aus
und stellte sie in unterschiedlichen Modi wie Kritikergespräch, Lesung eines
Kapitels, Film mit oder ohne Autor und/oder persönlicher Empfehlung eines
Kritikers vor. Das unterschied sich wohltuend sowohl von den im Befehlston den
Leser gängelnden Empfehlungsfetischismus wie auch vom längst clownesk gewordenen
Literarischen Quartett. Sie dauerte nach meiner Erinnerung eine Stunde,
war aber kurzweilig, ohne trivial zu sein. Damit sie auch garantiert keinen
Erfolg hatte, strahlte man sie auf SWF meist mittwochs gegen 23 Uhr und
als Wiederholung auf 3sat Sonntag vormittags, um 10 Uhr herum, aus. Es
findet sich noch eine Einschaltquote einer Sendung von 1998. Demnach wurden
einmal 0,04 Millionen Zuschauer gemessen, was einem Marktanteil von 0,3%
entsprach. Wenn man weiß, wie diese Zahlen ermittelt werden, weiß man auch, wie
hoch die Fehlertoleranz in diesem Bereich sein kann. Immerhin, so sagt man sich,
40.000. Ob eine Radiosendung im Deutschlandfunk, sagen wir der
Büchermarkt, eine ähnliche Quote hat? Aber, so könnte man fragen: Warum ist
eine Quote überhaupt relevant? * * * Mein zweiter thymotischer Moment mit Hubert Winkels ereignete sich im Juni 2021. Winkels war eingeladen worden, im Rahmen der »Tage der deutschsprachigen Literatur« zu Klagenfurt die Rede zur Literaturkritik zu halten. Der Text wurden größtenteils mit einer Mischung aus Unverständnis und Verstörung wahrgenommen. Wolfgang Tischer vom Literaturcafé nahm dies zum Anlass, Winkels, der pandemiebedingt in Berlin war, zu befragen. Das Gespräch dauerte fast 40 Minuten und man erlebte den Kritiker, wie er losgelöst von allen Verpflichtungen (er war seit kurzer Zeit auch nicht mehr Redakteur beim Deutschlandfunk) über sein Verständnis von Literatur und Literaturkritik sprach. Selten hat man einen Menschen aus dem Literaturbetrieb derart befreit reden hören. Er beschwor den »Funken eines magischen Weltverständnisses« als eine ästhetisches Ziel von Literatur. Dass die Rede auf Irritationen stoßen würde, nahm er bewusst in Kauf Und er haderte mit der aktuellen Literaturkritik, die sich immer mehr zeitgeistig gebe und als volkspädagogisches Instrument sehe. Ein schleichender Prozess sei das gewesen, so Winkels, aber all das war und vor allem: ist mit ihm nicht zu machen. Er hatte halt Glück, einen Kulturchef zu haben, der philologisch noch ambitionierter war als er selber und ihn schlicht »machen« ließ. All das wird in sachlichem, keinesfalls überheblichem Ton festgestellt. Der Frage nach der Notwendigkeit, Leser mit vielleicht etwas einfacheren Mitteln an Literatur heranzuführen widerspricht Winkels heftig. Das sei nicht seine Sache und als Tischer insistiert, verfällt Winkels gegen seinen Willen in Sarkasmus. Warum soll denn Lesen überhaupt etwas Besonderes sein? Das zweihundertjährige Projekt der Alphabetisierung erklärt er als abgeschlossen; längst würden doch alle lesen und man sei eher im Zeitalter der Ent-Alphabetisierung angekommen. Und ist es nicht so, dass die Menschen nicht zuletzt durchs Lesen so geworden sind, wie sie sind?
Das Spiel ›Masse gegen den Einzelnen‹ lehnt er ab. Und es sei auch »kein Wert an
sich, für wenige zu schreiben«, wehrt er den drohenden Elitarismus-Vorwurf ab,
um dann aber festzustellen: Nicht Reich-Ranicki, sondern Reinhard Baumgart und
Peter Hamm seien früher seine Helden gewesen. Und Schriftsteller wie der
»mittlere« Handke, der ihn besonders interessiert habe, mit Langsame Heimkehr
und Über die Dörfer; generell Schriftsteller, die sich sowohl gegen die
Avantgarde als auch gegen »die Vernutzung der Literatur« gewehrt hätten. Und
jetzt, ohne Verpflichtungen, könne er das Kaschieren der Konventionalisierung,
die man in den Medien fast zwangsläufig mitmachen muss, aufbrechen und den
(also: seinen) »anarchischen Reflex« wiederbeleben. * * * Winkels war nach Berlin umgezogen, beim Deutschlandfunk wurde seine Position mit einer mittelmäßigen Nachfolgerin besetzt. Ich glaube, er saß noch bis 2022 in der Jury zum von ihm einst mit konzipierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Hier und da schrieb er noch Kritiken, aber ich hatte ihn irgendwie »verloren«. Erst im September letzten Jahres bemerkte ich ihn bei einer Veranstaltung in Berlin anlässlich der Digitalisierung von Peter Handkes Notizbüchern im Publikum. Seine Bemerkung im Tischer-Gespräch zum »mittleren« Handke hatte ich zwischenzeitlich vergessen. Und jetzt dies: 1024 Seiten Blattwerk oder, wie bei mir, 19,78 MB E-Book, Die Hände zum Himmel lautet der Titel, »Über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr« steht darunter und ich muss, obwohl sogenannter Rheinländer, erst einmal nachschlagen, wo Gohr liegt. Die Wikipedia-Formulierung ist eher verwirrend: »Gohr ist ein Stadtteil der Stadt Dormagen im Rhein-Kreis Neuss«. Unter »geographische Lage« wird Gohr dann zum »Straßendorf«. Aus Winkels' Buch erfährt man die wirklich prekäre Grenzlage: In Gohr liest man die Rheinische Post, den Platzhirsch der Düsseldorfer Lokalzeitungen. Wenn es um Fußball geht, präferiert zumindest Winkels' Familie allerdings den 1.FC Köln und schon drei Kilometer weiter südlich liest man den Kölner Stadtanzeiger, »schon der Todesanzeigen wegen«. Die Rivalität, ja Aversion zwischen Köln und Düsseldorf ist Nicht-Rheinländern kaum vermittelbar. Jemand wie Winkels, der sowohl den Düsseldorfer wie den Kölner Karneval mitgemacht hat und dem Leser geduldig den Unterschied zwischen »Hoppeditz« und »Nubbel« erklärt, lässt sich davon wenig beeindrucken. Als er in den USA einmal nach seinem Herkunftsort gefragt wird, überlegt er kurz und nennt nicht das seinem Geburtsort näher liegende Düsseldorf, sondern seinen damaligen Arbeitsort Köln, in der Hoffnung, dass man dort wenigstens den Kölner Dom kennt. Vergeblich – der Gesprächspartner kannte den Dom nicht. Keine Sorge, die eintausend Seiten sind leserfreundlich in insgesamt 224 Kapiteln, eher Kapitelchen (die bisweilen auch ineinander greifen), unterteilt. Um das Dilemma um die Rivalen zu unterlaufen, ist der erste Teil mit »Vom Rheinland aus« überschrieben (162 Texte). Im kürzeren zweiten Teil heißt es dann »Von Berlin aus«, Tatsächlich gibt es eine Art Chronik, beginnend vielleicht Ende der 2010er Jahre und bis in die Gegenwart hinein. Unterbrochen wird sie regelmäßig von Rückblicken aus der Kindheit in Gohr, der Studienzeit, seiner rasch endenden Karriere als Drogendealer, den ersten redaktionellen Aufgaben im Stadtmagazin Überblick und schließlich den Erzählungen über die vielen Reisen, die zu bisweilen ausladenden kunst- und kulturhistorischen Erläuterungen über Orte, Landschaften, Denkmäler, Gemälde und vor allem (romanischen!) Kirchen führen. Man liest Umkreisungen von religiösen und heidnischen Auffälligkeiten wie etwa zur »Ziegenikonologie« vom Buch Daniel bis zum Büffelmann beim Kapitol-Sturm 2021 über den exzessiven Reliquienkult der katholischen und orthodoxen Kirchen, erhält einen Überblick über Engelarten und -hierarchien und bekommt erläutert, was der Zeigefinger Marias auf Bildern oder Figuren mit dem Penis des Christuskinds zu tun hat. »Da haben sich«, wie es einmal spitzbübisch heißt, »wundersamerweise Leitthemen und überhaupt starke Motivcluster herausgebildet, die nicht von Anfang an geplant waren.« Und so kommt Winkels vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man im Rheinland sagt, setzt sich keine Grenzen der Abschweifung und manchmal weiß man nicht so genau, ob das gut oder schlecht ist. Einzelne Motive werden ausgebreitet, verlassen und dann viele Kapitelchen später wieder aufgenommen und wie selbstverständlich weitergesponnen. Aufgelockert werden die Erzählungen, Berichte und Erklärungen durch mehr als 60 skizzenhafte, dem gerade behandelten Thema adäquate, kleine Zeichnungen, die vermutlich vom Autor stammen (Hinweise gibt es dazu nicht). Das Cover ist allerdings von Bansky, die Ziege am Abgrund. Lobenswert am Rande: Im E-Book sind (nicht immer erkennbar) einige Begriffe mit erklärenden Links unterlegt. Und so reist man mit Winkels von Gohr, Düsseldorf, Köln und Berlin nach Delphi, Skopje, Amsterdam, Griffen, Sulzbach-Rosenberg, Annaberg, Frankfurt, Mailand, Görlitz, St. Louis (Missouri), Düsseldorf-Güterbahnhof, Tokio (Fujisan), Jeju Paradise Hotel & Resort in Korea, Salvador de Bahia, Moskau, Kloster Gračanica und Belgrad (Liste unvollständig) und alles in plauderndem und, wenn es um Mythen und Religion geht, beflissenen kulturgeschichtlichem und zugleich interpretatorischen Duktus. Aber es finden sich auch Anmerkungen zu profanen Dingen, wie dem Aktuellen Sportstudio und dem sich dort ausbreitenden »latenten politischen Aktivismus« durch die Moderatoren, eine Hymne auf Büroklammer und Klarsichthülle, die Verteidigung der sogenannten Abendmahl-Szene bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024, der Versuch, die Frage nach dem Sinn von Museen zu beantworten, eine Schilderung der Faszination eines Alice Cooper-Konzerts, eine kleine Warenkunde über Zigarettenmarken der 60er Jahre und die Verheißung der Novesia Goldnuss-Schokolade. In der konzisen Analyse der immer stärker werdenden Robustheit des japanischen Fußballs unterläuft Winkels am Ende allerdings ein großer Fehler, in dem er beim Tor von Asano gegen Deutschland zum 2:1 bei der Weltmeisterschaft in Katar Kevin Trapp als chancenlosen Torhüter deklarierte – es war aber Manuel Neuer. Und da ich schon dabei bin: Der größte Fauxpas findet sich in der kleinen Karnevalskunde, in der Winkels auch die Aktivitäten anderer Städte streift, wie den Veilchendienstagszug in Mönchengladbach und als »Jeckenruf« fälschlicherweise »Halpohl« intoniert. Dabei müsste es natürlich »Halt Pohl« heißen. So sind sie halt, die Kölner (oder Düsseldorfer), wenn es um den Niederrhein geht. Vielleicht sind die immer wieder aufkommenden Erinnerungen an die Kindheit in Gohr die schönsten weil luftigsten Stellen, wobei Winkels nicht den Fehler macht, aus der Kinderperspektive zu erzählen. Hubert war, wie er heute feststellt, ein »bigotter Bengel oder frommer Knabe«, bekreuzigte sich immer, nicht nur wenn er an der alten, romanischen Kirche in Gohr vorbeikam, sondern auch wenn er ein Wegekreuz erblickte (einmal stürzte er dabei mit dem Fahrrad, was natürlich ausgiebig Stoff bietet). Und doch war er nur ein Tag Messdiener, nein, eher »Ministrant«. Zur besonderen Kindheitsfigur außerhalb der Familie wird der Pfarrer, der auch Hubert heißt. Naiver Kinderglaube, rheinischer Katholizismus der 1960er Jahre, Familientreffen mit zum Teil Kriegsversehrten (nicht nur körperlich), der stets zurückhaltende Vater, wenn es ans Geschichtenerzählen geht (»Wer wirklich etwas erlebt hat, redet nicht so viel«): Familien- und vor allem Zeitgeschichte. Die Mutter wurde mit sieben Jahren Vollwaise und die Art und Weise der Unfälle, bei denen die beiden Eltern in kurzer Zeit nacheinander starben, ist einer der »Zufälle«, von denen es in diesem Buch sehr viele gibt; freilich ein schlimmer Zufall. Sie kam zu Oma Vieten, eine fromme Frau, die ihre Stiefmutter wurde, aufs Land, musste täglich Feldarbeit leisten, für die Schule war wenig Zeit; man würde sie heute »funktionale Analphabetin« nennen, so Winkels und entdeckt beim Umzug in ein Heim Listen, mit denen sich die Mutter die Welt zurechtgelegt hat und das ist einfach eine großartige Stelle. Wie auch das sich irgendwann konkretisierende Portrait des Vaters, vor allem jene Schilderungen, wie er in den letzten fünfundzwanzig Jahren seines Lebens das Holzschnitzen entdeckte, sich eine eigene Welt damit erschuf und auch Aufträge entgegennahm (unter anderem Kopien der Madonna der Gohrer Kirche anzufertigen) - eine große Feier des Autodidakten, der von einem Schnitzer in Oberammergau, von dem er lernen wollte, früh nach Hause geschickt wurde, weil er schon alles konnte. Sein Verhältnis zur Mutter, die am Ende des Buches fast genau zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes stirbt (Menschen, die in einem Heim leben, sind übrigens keine »Insassen«, Herr Winkels), wird kontrastiert mit Eribons Mutter-Roman und dessen Umgang mit Krankheit und Tod. Winkels bekennt, er hätte das Buch besser nicht gelesen. Viel wird erzählt um die Großmütter, Onkeln, Tanten und Cousinen, vor allem mit und über Vetter Peter Kempermann mit »seinem« Lied, Die Hände zum Himmel titelgebend für dieses Buch und in doppelter Hinsicht Lebensmotto geworden oder gerade (wieder) werdend. Er erwog sogar, dieses Lied auf der Beerdigung der Mutter als Requiem spielen zu lassen, entschied sich dann jedoch für das »familienbildende« Que Sera, Sera (was, wenn man einige hundert Seiten zuvor die Erläuterung zum Hitchcock-Film in Erinnerung hat, passend ist). Zwei Rädchen greifen ineinander in diesem Hybrid aus Memoir und Transzendenzsuche. Einerseits eine Fast-Beschwörung eines »weltumfassend rheinischen Hochgefühls«, andererseits »die immer mögliche Reconquista meines Gemüts durch den katholischen Zufall.« Man merkt das suchende Ringen (oder ist es ein ringendes Suchen?), wenn er über das Gebet und die Rückwirkung des Gebets auf den Betenden räsoniert oder konstatiert, dass die Beichte erst die Sünde macht. Fragen, die sich wieder stellen. Also worum geht es? »Lob des Daseins, Lob des Schöpfers, was sonst schreibe ich denn hier?!« Und an anderer Stelle: »Mit wachen Sinnen zu übersetzen, überzusetzen, die Welt wohlwollend zu wandeln und sie ebenso zu verlassen: diese immer noch, wenn auch verzweifelt schöne, von religiösen Brosamen sich nährende heutige Welt«. Und dann passt es, dass der Wegfall religiöser Zeichen, vor allem auf den Friedhöfen (aber nicht nur dort) mehr als nur bedauert, nämlich beklagt wird. Groß auch das Unverständnis, das Sterbesakrament statt »Letzte Ölung« jetzt »Krankensalbung« zu nennen. Es sind solche Kleinigkeiten, die ihn umtreiben. »Letzte Ölung«, ja, der »Ausdruck war ein wenig erratisch, geheimnisvoll, nicht mehr ganz von dieser Welt. Und das war richtig so und gut. Doch er wurde vor Zeiten schon tabuisiert, weil er das Lebensende des Gläubigen mit aussagt. Aber um dieses Ende geht es doch! Und um den Eingang in die Ewigkeit in Christus.« Stattdessen, so echauffiert sich Winkels an anderer Stelle: »Krankensalbung, das Wort schmeckt, dem Salben zum Trotz, schon des groben Rhythmus wegen, nach moderner Flucht vor dem Ende, nach Medizin«. Flehentlich der Appell: »Haltet die Kirchen offen! Sie sind gebaute Freiheitsspielräume, die vom Druck individuell zugeschnittener moderner normativer Ordnungen entlasten, auch indem sie an die Vorgängigkeit der großen, nahezu ewigen Gefühlskollektive erinnern.« Und da fällt mir wieder Peter Handke ein: »Trösten, ohne den Trostlosen wahrzunehmen (die Kirche)«. * * * Erstaunlich, dass der Literaturkritiker Winkels nicht sehr viele Referenzen aus zeitgenössischer Literatur heranzieht. Stephanie Sargnagel kommt mit ihrem USA-Reisetagebuch vor. Es gibt kurze Episoden über Christine Wunnicke, Thomas Hettche, Esther Kinsky, Ronya Othmann, Olga Tokarczuk, Emmanuel Carrère, Christian Lehnert, Emanuel Maeß, Gert Loschütz, Simon Strauß, Jan Faktor, Norbert Scheuer und Bernd Cailloux (auch diese Aufzählung ist nicht vollständig). Zwar schätzt er Martin Mosebachs Romane, geht aber mit dessen »radikal und böse-empört[en]« Kritik über das Zweite Vatikanische Konzil nicht konform. Mehr gibt es zu Thomas Meinecke, der partiell eine Art Weggefährte zu sein scheint. Besondere Verbundenheit spürt man beim 2005 verstorbenen Freund Thomas Kling (Winkels' druckt seine Trauerrede ab). Zwei Entfremdungen werden mitgeteilt. Die Ausführungen zu Patrick Roth erschließen sich vermutlich nur demjenigen, der sich ein bisschen mit dessen Werk auskennt. Bei Heimo Schwilk verwendet er sofort den Begriff »umstritten« und quantifiziert ihn als »Rechten«, um dann ein bisschen zurückzurudern: »Das ist nun keine Kategorie, mit der man einen Menschen fassen zu können glauben sollte.« Stimmt, aber warum macht man es trotzdem? Speziell, weil ambivalent, ist Winkels Umgang mit Peter Handke. Er schildert auf eine vertrackte Art seine Eindrücke von der bereits erwähnten Veranstaltung vom September 2024 und bezeichnet die mit Handkes Werk befassenden Protagonisten (unter anderem Projektleiter und Editionsleiterin der digitalen Edition der Notizbücher Handkes) als »Jünger«. An anderen Orten im Buch wird der Bildverlust erwähnt und einmal Langsame Heimkehr in einem Namedropping-Anfall zur »angelischen Poesie« gezählt, zusammen mit »William Carlos Williams und Günter Eich, Robert Walser (Das Zufällige ist immer das Wertvollste).« (Kursiv im Original; es handelt sich um ein Zitat aus Geschwister Tanner.) Überhaupt fällt auf, dass Winkels sparsam mit seinen beruflichen Erlebnissen umgeht. Man erfährt zu Beginn, dass im Redaktionsbüro ein Plakat mit »INHALTE ÜBERWINDEN« und »INNEHALTEN« hing und das man ihm einst als Willkommen einen Weltempfänger im Lederfutteral geschenkt hatte, der schweigend im Regal unter Büchern steht. Wer Betriebsklatsch erwartet, wird herb enttäuscht; nur einmal wird ein nicht namentlich genannter »Berliner Berufsleser« ironisiert, »dessen Name mir gerade unter den Tisch gerutscht ist«. Literaturkritische Programmatik bleibt fast ganz unberücksichtigt; nur einmal wird schüchtern der Habermas-Aufsatz über Literatur in Stellung gebracht und mit Novalis' »Die Welt muss romantisiert werden« ausgekontert. Immerhin ahnt man jetzt, dass Winkels' 2006 in die Debatte eingebrachte Dichotomie der Literaturkritik von Gnostiker und Emphatiker erweitert werden muss auf ein drittes, vielleicht das in Wahrheit einzig sinnvolle, Temperament: das des Romantikers. Man erfährt noch aus Tempo-Redaktionszeiten, dass Christian Kracht »besonders blond, blauäugig und hochnäsig« war und zusammen mit Eckart Nickel feixend in »Tenniscluboutfits« auf die Welt schaute. Später stellt Winkels fest, dass Krachts Faserland und Eurotrash »Wallfahrten zu Dichtergräbern« sind. Traurig ist er halt, dass es keinen Buchmesse-Empfang mehr auf der Klettenbergstraße 35 gibt. Ansonsten erfährt man von der Buchmesse über Winkels' Besuche der Frankfurter Hauptkirche. Das er dort einmal »zu schlummern begonnen« hatte, und dann, Stunden später, von »Beterinnen, weit mehr als ein Dutzend, zwei Männer darunter und ein Geistlicher, nicht im Ornat, sondern im schlichten schwarzen Talar« geweckt wurde. Sie »beteten, beteten unentwegt, ohne aufzuschauen.« Kann es was Schöneres geben? Das Buch endet mit der Betrachtung der neuen Berliner Wohnung im Umfeld des Bayerischen Viertels. Winkels rekapituliert kurz die Geschichte des Viertels und der Wohnung. Er, der durchaus Denkmäler kritisiert (bspw. das Erinnerungsmal an die »Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft« in Berlin), ist ergriffen von den Blumen auf den »neun Messingplatten auf je einem kleinen Betonkubus, eingelassen in die Erde«, mit den Namen der Menschen, die einst im Haus gewohnt hatten und von den Nazis ermordet wurden. Er zählt die Namen auf. Fin. Recht so. Und jetzt möchte der Leser womöglich ein Urteil haben. Lohnt die Lektüre? Was ist mit der Transzendenz-Suche des Verfassers? Ist sie vielleicht nur ein Denkspiel? Man erinnert sich an Camus, der die Rückkehr zur Religion im Angesicht des Alters (und Todes) als Schwäche verwarf. Winkels' Reconquista bleibt, um ein Lieblingswort von ihm zu zitieren, zuverlässig und gewollt im Numinosen. Der »Friede mit dem Schrecken der Vergänglichkeit« will intellektuell begangen werden; es ist eine Balance am Abgrund, wie Banksys Ziege. Als Kamin- und Winterlektüre ist das Buch nicht nur, aber vor allem für Rheinländer vorzüglich geeignet.Artikel online seit 10.07.25 |
Hubert Winkels |
||
|
|
|||