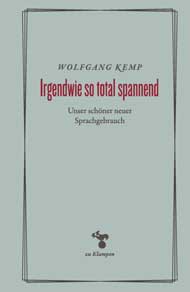|
Die Erneuerer einer
Institution hinterlassen oft einen größeren Scherbenhaufen als die Anhänger der
alten Ordnung, die vorgeblich überwunden werden soll. Das ist eine Weisheit, die
auf Michel Foucaults Untersuchungen zur Reform der Psychiatrie zurückgeht. In
diesem Sinne schreibt der Hamburger Emeritus für Kunstgeschichte
Wolfgang Kemp
seine
Sprachkritik. Sie erschien in einer Reihe von Glossen in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung und ist nun als durchgängiger Text in der Ausgabe des zu
Klampen Verlages erhältlich. Adornos Jargon der Eigentlichkeit oder
Eckhard Henscheids Dummdeutsch sind ebenso wie Ernst Cassirers
Symbolische Formen oder Karl Kraus‘ Sprachkritik in diesen Texten immer
präsent. Kemp ist nicht allein als Leser und Hörer, sondern auch als
aktiver Sprachnutzer gebeutelt. Da sind zum Beispiel die Urteile, die sogenannte peer
reviewer – offiziell im Rahmen einer objektiven Wissenschaft, in
Wirklichkeit aber als Resultat verschiedener Seilschaften dortselbst – über
seine eigenen Texte in Sammelbänden und wissenschaftlichen Zeitschriften gefällt
haben. Sie kannten ihn und seine Arbeit definitionsgemäß nicht und konnten sich
entsprechend ihrer eigenen Vorurteile daran auslassen. Außerdem ist Kemp dem
Medium Radio sehr verbunden, und das nicht erst, seit er als Autor eines
Artikels im Funkkolleg tätig war.
Als regelmäßiger Hörer des Deutschlandfunks und entsprechender Podcasts über
Kunst, Politik, Literatur und Kultur ist er auf diese Weise einer verschliffenen
Sprache ausgesetzt. Nun schlägt das Imperium zurück. Denn das vorletzte Medium
ist keinesfalls der Hort der Kultur, als der es sich gegenüber dem letzten oft
genug ausgeben will.
Kemps Buch hat drei Teile: Im ersten beschäftigt er sich mit Sprachpartikeln als
Füllsel, im zweiten geht es um die bürokratische Seite der neuen
Sprachverordnungen von Universitäten und politischen Verwaltungen unter der
Ägide der political correctness und dem Gendern; der dritte Teil arbeitet
sich an der Welt der modernen Adjektive des Vagen ab. Die Grundlage seiner
Kritik bildet der Übergang vom traditionellen Medium der Schrift und des Bildes
wie dem Buch und der Zeitung zu demjenigen des Radios und hier speziell der Welt
des Podcasts, die mit dem Internet entsteht. Die sich in einem Medium elaboriert
und formell ausdrückende Schriftstellerinnen und Schriftsteller wollen sich in
dem anderen volksnah und informell geben. Daraus entsteht oft genug eine
ungenaue Sprache, die – weiter unterfüttert durch den Gebrauch in den
sogenannten sozialen Medien – auf den schriftlichen Ausdruck generell
zurückschlägt. Diese Ungenauigkeiten, die Kemp treffsicher aufspießt wie den
Schwarm der kleinen Partikel – „so“, „halt“, „eben“, „eh“, „sowieso“,
„sozusagen“, „geht in Ordnung“ oder „genau“ – erscheinen aber nicht zufällig,
sondern sie bilden ein System. Dieses kommt George Orwells „Neusprech“ aus
seinem Roman 1984 bereits gefährlich nahe. Eine verschlissene Sprache ist
Ausdruck eines entsprechenden Denkens und wirkt auf jenes wieder zurück.
Dahinter steht eine Tatsache, die bereits Pierre Bourdieu aufgefallen ist,
wonach das betroffene Medium (mit Ausnahme des ansonsten viel gescholtenen
Buches) selbst kaum in der Lage ist, erschöpfend in einer Selbstkritik über sich
zu reflektieren. Bourdieu spielt das am Beispiel des Fernsehens durch.
Kemp wählt sich für seine Beispiele hauptsächlich das Radio und den Podcast,
aber auch neue Romane und andere Äußerungen der Pop-Kultur wie Filme, Memes und
was das Internet sonst so im Umgang mit der Sprache hergibt.
In Tateinheit mit einer Genderreform der Sprache macht er die Tendenz zur
Ent-subjektivierung aus, indem – wie in dem prominenten Beispiel von den
„Studenten“ nun nur noch von „Student_innen“, „Student:innen“ oder
„Student*innen“ die Rede sein soll oder eben von Studierenden. Was diese
aus der ASCII Tastatur stammenden Zeichen und die Gerundiumform mit der Sprache
macht, fällt gewöhnlich aus der Wahrnehmung derjenigen, die diese neue Sprache
samt ausgeschlossenen F-, N- und L-Wörtern forcieren, heraus. Ausgehend von
einer Bürokratisierung geht es hier also um einen Umbau der deutschen Sprache.
Für die Lesenden glücklich, verfügt Kemp über genügend Kenntnis der
entsprechenden Literatur und des Sprachverständnisses auch außerhalb des
Deutschen: Die wesentlichen Beispiele entnimmt er auch der englischen und
lateinischen Sprache, um historische und aktuell Entwicklungen – von like
etwa im amerikanischen Englisch – als Referenzgröße aus den Regionen jeweils
heranziehen zu können, die hier den Ton angeben.
Kemp ist von Haus aus Kunsthistoriker. Seine wichtigsten Beispiele stammen denn
auch aus dem Kunstbetrieb, wo die Sprache ohnehin Beigabe ist zum Wesentlichen,
nämlich dem bildenden Kunstwerk. Dieses spricht zwar bekanntlich seine eigene
Sprache, es bleibt aber innerhalb der Menschensprache stumm. Nicht nur die Neue
Musik lebt ja von der Pause zwischen den Tönen, auch wenn sie sich wie eine
beliebte Sendung im Deutschlandfunk Zwischentöne nennt. So nimmt es kein
Wunder, dass hier von Kemp im Feld der Sprache die allgemeine Kritik am
Kunstbetrieb bestätigt wird, die der schwedische Regisseur Ruben Östlund 2017 in
seinem Film The Square, aufgemacht hat (und damit im selben Jahr die
Goldene Palme von Cannes gewann). In diesem Film, der in einem Stockholm der
verlotterten Kunstszene spielt und damit auch das entsprechende Leben der
Nobelpreisakademie vorführt, ist die Kunst nur die Beigabe zum Leben: Kunst ist,
was im Museum ist oder was der Künstler macht. Diese haltlosen Aussagen
innerhalb des Betriebs finden in dem Film ihr Korrektiv in der Theorie des
dänischen Philosophen Søren Kierkegaard.
Der auch von Kemp ausgemachte Trend zur Verunsicherung der Sprache im
Kunstbetrieb entstammt neben dem Feld zwischen geschriebener und gesprochener
Sprache offensichtlich dieser Sphäre der sprachlichen Beigaben zu Werken der
Bildenden Kunst – als Titel, Katalog- und Verkaufstexten der Werbung und
Reklame:
»Als
Deutschland 2000 die Weltausstellung in Hannover veranstaltete, hieß der
Kunstbereich »In-Between«. Genau dort finden wir die Kunst weiterhin. Eine
Berliner Galerie hat oder hatte bis vor kurzem Ausstellungen mit folgenden
Titeln im Angebot: »Forms of Misleading«, »Renegade Dreams Hanging from the
Clouds«, »Navigating the Unknown«, »Sensitive Euro Man«, »Growing Pains«,
»Melting«, »Infinite Unfolding«. Das alles ist so eindeutig ambivalent, so
zipfelsinnig vulnerabel und entschieden in-between! Diese Titel enthalten wie
Einschlüsse die Keime des aktuellen Sprachgeschehens; sie sind Partikeln im
Großformat, vor allem Abtönungspartikeln wie »irgendwie«, »ein bisschen«, »so'
ne«. Und man erkennt schon an dieser kurzen Strecke, dass der Kunstbetrieb ohne
das Gerundium zumachen könnte. Das liegt zuallererst daran, dass Galerien nur
noch auf Englisch schreiben und in dieser Sprache das Gerundium sehr viel
»natürlicher« ist und frei von der Aufgabe, Gerechtigkeit zwischen den
Geschlechtern herzustellen.«
In der Welt der Kunst
ist das Inkommensurable und Unsagbare im Gesagten oft genug als Fetisch so
anwesend wie abwesend: „[...] wovon man spricht, das hat man nicht.“ Das wusste
bereits der Romantiker Novalis. Kein Wunder also, dass der
„Sonntagssprachforscher“ (Kemp über Kemp) dann auch besonders bei der
Bilderschrift der Emoticons hellhörig wird. Stammen diese neuerdings doch aus
Japan, in der Renaissance aber nach dem Urteil des Kunsthistoriker-Kollegen
Rudolf Wittkower aus Ägypten.
Der heutige Mensch trägt dagegen seine Marker nicht nur auf dem Handy mit sich
herum, sondern auch auf der Haut. Kemp fragt nach deren Herkunft und Funktion
als Bildmotive:
»Eines
der beliebtesten Tattoo-Muster von heute ist übrigens das Kettenrad, ein Beweis
dafür, wie das Dispositiv Gestell im digitalen Zeitalter fortlebt. Im übrigen
finde ich, dass die Neo-Pronomen sich stilistisch als Tattoos eignen, sobald sie
die Kennzeichnung der Basisgeschlechter verlassen. Die spanischen Neo-Pronomen
ell@ und a@ B. ergäben schöne Vorlagen für den Tätowierer. Aussprechen kann man
sie ohnehin nicht, und die Assoziation mit dem @-Zeichen ist falsch. Vielmehr
wird das weibliche Suffix »a« in ein männliches Suffix »o« eingeschrieben und
damit die binäre Geschlechtlichkeit neutralisiert. Solche Ansätze zu einer
Neo-Emblematik rühren sich überall. Man denke an das kaum mehr überschaubare
Feld der Memes.
Auf jeden Fall ist das Repertoire an Zeichen und Zeichensystemen, ist die
»Schattenwelt der >Bedeutungen<« (Susan Sontag) jetzt groß und multimedial
genug, um die Identität eines Individuums mit Markern umfassend abbilden zu
können: »Ich sag mal so: Als Tattoos trage ich das Kettenrad und mein
Sternzeichen. Meine Pronomen sind im Moment xer und zier. Zu meinen
Lieblingsemojis gehören >upside-down-face< und >slightly-happy<. Beim Gendern
verwende ich den Asterisk und meine denselben, wenn ich den Glottisschlag
spreche. Und auf meinem Outfit führe ich die Marker der Marken Nike, Moncler und
True Religion aus. Mein Symbolgebrauch ist sozusagen intersektional.«
So redet die/der von
Kemp gefundene ideelle Sprecher_:*in der heutigen Zeit.
Was für ein Unterschied zu den gebashten Schriftstellern wie Ernst Jünger, über
den Kemp im Podcast Lakonisch elegant des Deutschlandfunks in der Folge
mit dem Titel „Überall Krise: Kann Ernst Jünger was dafür?“ das fluide Urteil
eines Literaturkritikers gehört hatte: „Von Ernst Jünger ist das ja auch so ein
bisschen bekannt, das ist sehr anstrengend zu lesen.“
Die Sendung kam anscheinend ohne Belege aus. Kemp macht sich dann auf und
interpretiert seinerseits eine Stelle aus Jüngers Textsammlung Das
abenteuerliche Herz, in dem es um den Lummenflug auf Helgoland geht: „Gleich
darauf sah ich die Vögel von der Klippe abstreichen; ihre Niststätten waren
durch den überhängenden Fels gegen die Sicht gedeckt. […]“ Hier findet Kemp
allerdings bei Jünger durchaus eine elaborierte Verbindung von Schriftlichkeit
und Mündlichkeit. Diese unterscheidet sich trotz dessen unbestritten prekärer
politischer Haltung doch meilenweit von der formalen Ausdrucksfähigkeit der PodcastteilnehmerInnen. Mit formalen wie inhaltlichen Widersprüchen auch
sprachlich zu leben, bedeutet für Kemp also nicht, sich selbst einer ungenauen
Sprache anheim zu geben. Das führt er in seinen Kommentaren nachdrücklich vor.
P. S: Das Rechtschreibprogramm von Word versucht übrigens beim Schreiben der
Kritik unablässig „Kemp“ durch „Camp“ zu ersetzen und möchte statt „Niststätten“
„Nesthäkchen“ setzen.
Artikel online seit 22.09.25
|
Wolfgang Kemp,
Anne Hamilton
Irgendwie so total
spannend
Unser schöner neuer
Sprachgebrauch
zu Klampen Verlag
18,00 €
9783987370342
|