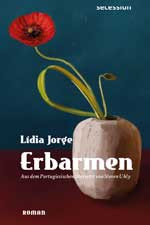|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
|||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
|||
|
|
|||
|
|
Überleben im Paradies & der Hölle Lidia Jorges Roman »Erbarmen«
Von Wolfram Schütte |
||
|
Als Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Große portugiesische Literatur der Gegenwart überall auf der Welt entdeckt & verlegt wurde, gab es nur eine Autorin, die auf dem Weg war, mit den Romanciers António Lobo Antunes (*1942) & José Saramago (*1922) künstlerisch auf gleicher Höhe zu konkurrieren: die 1946 an der Algarve geborene Lidia Jorge.
Seit ihrem Debüt
»Der Tag der Wunder«, das 1989 ins Deutsche
übersetzt wurde, sind einige ihrer 13 Bücher bei Suhrkamp erschienen – fast
immer in der Übersetzung Karin von Schweder-Schreiner. Nur ihr jüngster Roman
»Erbarmen« wurde nun von Steven Uhly im Verlag »Secession« vorgelegt.
Möglicherweise hatte Suhrkamp die Autorin »freigestellt« & der kleine wagemutige
Verleger Ruzicska hat beherzt zugegriffen. Erzählt wird darin von Leben & Lieben, Sterben & Erinnern in einem portugiesischem Altenheim, das einmal ein großes Hotel mit Garten war & jetzt »Paraiso« heißt. Es wird vornehmlich von Witwen unterschiedlicher Herkunft, Klassenzugehörigkeit & physischer Verfassung bewohnt. Das Kaleidoskop der »Heldinnen« reicht von einer Adligen bis zu einer Analphabetin – was schicksalhaft für die greise Erzählerin Dona Maria Alberti ist, die im Rollstuhl sitzt. Die Witwer, die dort auch ihren Lebensabend verbringen, sind meist nur mit sich & ihresgleichen lesend/rauchend, Karten spielend beschäftigt, wenn sie nicht zu den drei im Laufe der Zeit hinzugekommenen schönen, gebildet-kultivierten Gentlemen gehören, die von den älteren Damen (incl. der Erzählerin) angeschwärmt werden, diskret aber zu letzten fleischlichen Liebhabern der attraktiven Dona Joaninha werden. Dabei hatte die Rollstuhlfahrerin Maria Alberta als erste zu dem Neuling Sargento Joao Almeida Kontakt gehabt, weil er mithilfe seines Handys ihr geholfen hatte, eine sie lange schon plagende Gedächtnislücke zu schließen. Erst nach seinem überraschenden Tod erfährt sie von seiner Liebhaberin, dass er ihr eine Botschaft an die Erzählerin gegeben hatte, die von der Analphabetin jedoch aus ängstlicher Eifersucht nicht an Maria Alberta weitergegeben worden war. Seit sie nun gelesen hat, was Sargento Almeida ihr mitteilen wollte (»Dona Alberta fragen Sie mich, wann immer Sie mögen. Ich habe alle Informationen, die Sie brauchen in meinem Handy«), wird der im Buch wiederkehrende Satz für die trauernde Liebende Alberta zum Menetekel einer verhinderten letzten Liebeserklärung. Eine vertrackte erzählerische Volte, die nicht ohne Ironie ist. Erzählt wird der ebenso umfangreiche wie ereignispralle Roman in der Form einer immer wieder neu ansetzenden monologischen Form, wie sie uns aus der Polyphonie des Romanwerks von Lobo Antunes vertraut ist. Im Gegensatz zu ihm, der seine Helden & Heldinnen gewissermaßen aus dem Stand heraus memorieren & fabulieren lässt, hat seine jüngere Kollegin ihr »Erbarmen« mehrfach dramaturgisch »verschnürt«. Bevor man zum Stoff selbst gelangt, wird man als »Besucher« von der »Heimleiterin« empfangen & über die Gepflogenheiten & Verhaltensweisen im Paradies des Alterns informiert. Darauf folgt eine »Poetische Beschreibung« vom Hotel Paraiso: eine salbungsvoll-religiöse Eloge »in den Worten unserer Bewohner« auf die Anstalt, verlogen bis ins Letzte, wie derlei christliche Hospize sich überall auf der Welt anbieten. Schließlich folgt noch eine pseudowissenschaftliche Seite, die suggeriert, die folgenden Texte seien »die Transkription einer 38 Stunden umfassenden Audiodatei«, die »Maria Alberta Nunes Amado zwischen dem 18.April 2019 und dem 19.April im folgenden Jahr mit einer Olympus Note Corder P-20 aufgenommen« habe. Auf der letzten Seite des Buchs widmet Lidia Jorge den Roman ihrer Mutter (»die mich gebeten hat, diese Geschichte zu schreiben«) & dem chilenischen Autor Luis Sepúlveda. Als genügte der Autorin das literarisch-humoristische Spiel mit der autobiographischen Suggestion noch nicht, lässt sie ihre eloquente Erzählerin auch noch Mutter einer Schriftstellerin sein, die der Tochter vorwirft, nur mäßig erfolgreich zu sein, weil sie nicht biografische Romane über historische Prominente schreibt. Denn die lesen ihre Altersgenossinnen im Altenheim. Zugleich lässt sich ihre Mutter zweimal Erzählungen vorlesen, die Sepúlveda geschrieben hat & ihre Tochter besucht den »alten Freund« auf ihrer südamerikanischen Lesereise in Santiago de Chile. Der Name des chilenischen Autors fällt nicht einmal in der Romanhandlung. Diese augenzwinkernden postmodernen Spielereien gehören zum humoristischen Humus des sehr ernsten Sujets, das ohne Zweifel zu den »offenen Geheimnissen« unserer modernen Gesellschaften zählt. Nur die Allerreichsten fürchten das hohe Alter nicht, weil sie im eigenen Zuhause ihren Exitus erwarten können. Was in den Geschlossenen Anstalten der »Altersheime« geschieht & man vom Hörensagen weiß, reicht einem eher zu Furcht & Schrecken, als dass es neugierig auf einen Roman machen würde, der dem eigenen Erleben erzählerisch vorauseilt. Will sagen: je näher man selbst existenziell dem Altersheim ist, desto eher dürfte man erst einmal mit der Lektüre von »Erbarmen« zögern. Dabei ist die Evokation des Alltags im Paraiso durch die Augen der dort auf eigenen Wunsch lebenden Dona Alberti doch höchst ansprechend, ja ebenso unterhaltsam wie spannend. Das liegt daran, dass es Lidia Jorge mühelos gelingt, die kleine Welt des Hauses, seine unterschiedlichen Bewohner & das Dienstpersonal aus aller Herren Länder als einen lebendigen Corpus der menschlichen Wünsche, Sehnsüchte & individuellen Eigenarten darzustellen. Oft fügt sie den Kapiteln, deren Titelei sich mir nicht erschlossen hat, kleine lyrische Vignetten hinzu. Wie im »wirklichen Leben draußen«, geht es auch im abgeschotteten Seniorenheim zu: mit erotischen Verwicklungen, Antipathien & Sympathien, zärtlicher Solidarität & brutalem Verbalismus oder Rassismus & Homophobie. So vertreiben durch ihr diskriminierendes Hänseln die Männer einen schwulen Pfleger, der bei den Witwen sehr beliebt war – oder vergiften bellende Hunde durch Glas in ausgestreuten Fleischstücken. Besonders einfallsreich ist der Umgang der Erzählerin mit der Nacht, von der sie gleich im ersten der rund 80 Kapitel behauptet, dass sie »immer länger ist als der Tag…Die Nacht kommt gerade mitten in der Nacht zu mir und stellt mir unvorstellbare Fragen, als wäre sie diese uralte braune Katze namens Sphinx«. Es ist geradezu unheimlich, wie alptraumhaft Lidia Jorge das schlaflose, grübelnde Wachliegen ihrer Erzählerin im Bild der wiederholt aus der Zimmerwand tretenden, sie bedrängenden Nacht verdichtet. Sehr bewegend ist auch, wie Maria Alberta, gewissermaßen als Beichtmutter, das »Frühlingserwachen« des Bauernmädchens Lilimunde, miterlebt (& fördert!), das zu der multikulturellen Schar der Betreuerinnen zählt - & so unwissend auf dem katholischen Land gehalten wurde, dass sie glaubte, die Frauen seien entstanden, indem den Männern ihr Geschlechtsteil weggenommen wurde. Die erotisch erweckte Lilimunde entdeckt jede Nacht aufs Neue mit einem ungarischen Austauschstudenten die Freuden der körperlichen Liebe & erzählt Dona Alberti jedes Mal erregt davon, was Maria Alberti an ihre eigene geheime Liebschaft mit einem Filou erinnert, der sie mit der Frucht der Beziehung, ihrer Schriftsteller-Tochter, sitzen ließ. Die schwangere Lilimunde aber hat dem nach Ungarn zum Arbeiten zurückgekehrten Liebhaber verschwiegen, dass sie ein Kind von ihm erwartet, das sie in freudiger Erwartung austragen wird… Einmal erleben die Bewohner des Paraiso den großen Überfall eines Ameisenheeres in ihren Zimmern & Betten. Diese kollektive Heimsuchung durch die zwickenden Insekten ist gewissermaßen das helle humoristische Vorspiel für die dunkel timbrierte Sonorität der Corona-Pandemie, die das Paradies der Senioren in ein gespenstisch menschenleeres chaotisches Hotel der vorübergehend vollkommen allein gelassenen Hilfsbedürftigen verwandelt.
Aber Dona Alberti
überlebt auch diese verheerende Pandemie, die so viele ihrer Mitbewohner
dahinrafft & die Bediensteten – sofern sie nicht geflohen sind – zu
»Astronauten« (in Schutzanzügen) mutiert. Im letzten Kapitel wappnet sich die
Erzählerin zum ultimativen »Kampf« mit der Nacht. (Ich assoziierte das Ende von
Ingmar Bergmans »7. Siegel«, als der Ritter, der das Schachspiel gegen den Tod
verloren hat & von ihm abgeschleppt wird, zuletzt sagt: Ich folge, aber unter
Protest). Aufmüpfig bis zuletzt ist auch die Heldin Lidia Jorges:
»Lass mich in Ruhe,
Nacht. Ich bin voll Energie, ich will zurück auf den Schulhof und springen, bis
mein Hut wegfliegt«. |
Lídia Jorge |
||
|
|
|||