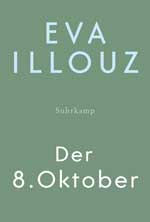|
Eine halbe Frage
Die
französisch-israelische Soziologin Eva Illouz gilt als eine Spezialistin für die
Funktionalisierung von Gefühlen in der Politik. Sie beginnt ihren Essay mit
einer Frage. Diese enthält ihr Programm:
»Bis
zum 7. Oktober 2023 glaubte ich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien die
letzten Ereignisse, die abweichende Überzeugungen und Meinungen in einer
moralischen Gemeinschaft des Mitgefühls noch zusammenbringen könnten. Und mir
schien, dass die politische Sensibilität, die sich am ehesten über Gräueltaten
empören würde, meine sei, die linke. Ich habe mich geirrt. Ein beträchtlicher
Teil der globalen Linken — unter wechselnden Namen wie identitäre, wache bzw.
aufgeweckte, dekoloniale oder progressive Linke — hat die Existenz dieser
Gräueltaten geleugnet oder sie als Akt des »antikolonialen Widerstands«
gefeiert. Diese Linke hat die schockierten und leidtragenden Juden im Stich
gelassen, ignoriert, stigmatisiert und einer vermeintlichen Urschuld, des
israelischen Kolonialismus, bezichtigt. Warum? Wie ist es so weit gekommen?«
Illouz betreibt im
Anschluss ein Sprachspiel, wenn man das in diesem Fall sagen darf, zwischen den
Daten des 7. und 8. Oktober 2023. Am 7. Oktober erfolgte der bestialische
Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, am 8. Oktober gab es
erste weltweiter Beifallskundgebungen zu diesem Massaker. Eine irgendwie
geartete Zustimmung sei, wenn überhaupt, erst gerechtfertigt als Reaktion auf
die darauffolgenden überzogenen Maßnahmen der israelischen Armee gegen die
Palästinenser, so Illouz weiter. Dabei reagierte Israel zunächst mit Drohungen
und Ankündigungen; der Einmarsch in den Gazastreifen fand am 29. Oktober statt.
Erst das hätte der Freundenfeststimmung – wir erinnern uns, in Berlin z. B.
wurden Süßigkeiten auf der Straße verteilt – weltweit einen, wenn auch schrägen,
Grund geben können.
Das ist richtig. Mit solchem Argument blendet Illouz allerdings zugleich die
Vorgeschichte des Konflikts aus, auf die die „Razzia“ der Hamas eine Reaktion
darstellt. Aber von einem reziproken Verhältnis im Sinne von actio und
reactio kann man in diesem Fall wohl kaum reden, der mit Recht als
schlimmste Tat an Juden nach dem Holocaust gilt. Es geht hier vielmehr jeweils
um Akte der Aggression, die als eine „Rache“ nur rationalisiert werden. Aber
ähnlich wie im Konflikt der Ukraine mit Russland ist es gerade aus einer
reflektierenden Verteidigungsposition notwendig, das Gegenüber und seine Motive
sowie die Verschränkung mit der eigenen Position genau zu kennen. Die Leugnung
einer solchen Dialektik und die Reduktion des Anderen auf ein „Böses“,
beschädigt als verzerrende Weltsicht und als unzureichende Grundlage zuallererst
die eigenen Urteile. Ähnlich wie Immanuel Kant sich mit der Einhaltung des
kategorischen Imperativs gegen die Lüge ausspricht, um die eigene Integrität
nicht zu gefährden – weil man nämlich nicht mehr weiß, wie und wann man gelogen
hat – so wirkt auch das Bild eines Feindes, mit dem man sich nicht gemein machen
will, auf den Verteidiger zurück. Zumindest das ist an Carl Schmitts
Freund-Feind-Dialektik, die ansonsten zu Verkürzung und Verkennung jeder Lage
führt, ein richtiges Moment.
Wenn man also dem Anderen vorwirft, eine moralische Gemeinschaft zu verlassen,
muss man auch in der Lage sein, eine Selbstkritik zu üben.
Theorie in Anführungszeichen und die soziale Mobilität der Juden
Illouz untersucht also
aus ihrer Position heraus in acht kurzen Abschnitten, wie es zum Vorwurf eines
neuen moralischen Antisemitismus von Seiten der Linken kommen konnte. Sie nennt
unter anderem Angela Davis, Judith Butler und Andreas Malm aus Lund als deren
Unterstützer und erläutert das Abhandenkommen einer normalen Mitleidsreaktion
mit den jüdischen Opfern der Hamas. Einen Grund dafür sieht sie in einer Theorie
der Postmoderne, die sie als „Denkstil einer French Theory“ bezeichnet
und im Text konsequent in Anführungszeichen setzt. Damit betrachtet sie die
Philosophie aus der Perspektive eines angelsächsischen Pragmatismus und spricht
ihr einen Erkenntniswert rundweg ab.
Mit Bezug auf Jacques Derrida und Michel Foucault mit ihren
strukturrealistischen Theorien der Dekonstruktion und der Macht, identifiziert
sie eine systematische Verkennung der Welt. Deren Kennzeichen seien eine Kritik
der Aufklärung und Bezüge zu autoritären Denkern wie Marquis de Sade, Friedrich
Nietzsche, Martin Heidegger und Carl Schmitt. Dazu gehöre weiter ein
Pantextualismus, wonach es nichts außerhalb des Textes gebe. Der Marxismus werde
offiziell verworfen, die neue Struktur der Macht beziehe sich stattdessen auf
Begriffe wie Disziplin, Überwachung, Orientalismus. Dazu träten eine überzogene
Form der Kritik ebenso wie ein hypostasierter Strukturalismus als haltlose
Machttheorie, die alles infiziere.
Mithilfe einer solchen „Theorie“ würden, so Illouz weiter, die Juden aus der
Rolle der Verdammten dieser Erde und der Geschichte herausgenommen und nun den
Mächtigen zugeschlagen. Eine Konkurrenz unter den Opfern und die Fähigkeit der
Juden zu einem sozialen Aufstieg treibe einen solchen Wechsel an. Mit dem
Holocaust, dem Status als Minderheiten in anderen Ländern und dem Kampf gegen
die britische Kolonialmacht in Israel sollten die Juden aber zu einer solchen
Opfergruppierung gehören.
Eine Opfer-Konkurrenz der Minderheiten nun ohne Juden
Illouz erläutert das
weiter an der Verbindung von Juden und Schwarzen in den USA und in Frankreich.
Historisch gehörten die Juden zu den diskriminierten Minderheiten. Mit dem
Holocaust als Kulturbruch entsteht eine Konkurrenzsituation nicht nur zur Lage
der schwarzen ehemaligen Sklaven, sondern auch zu anderen Unterdrückten. Indem
Israel sich mit westlicher Hilfe im Nahen Osten als Staat der ersten Welt
etabliert hat, gebe es vorschnelle Schlüsse. Die Wahrnehmung der Juden als
Israelis oder Zionisten erfolge nun insgesamt in verkürzter Darstellung als ein
Apartheidsregime. Illouz erläutert, dass eine solche Ideologie dazu beitrage,
die Theorie des Dekolonialismus auch noch nach Ende der Kolonien als
Superstruktur aufrechtzuerhalten. Damit würden die Ungerechtigkeiten verdeckt,
die die neuen Regime sich selber zuzuschreiben hätten.
Dekolonialisierter Islamismus?
In einer Verbindung
dieser Theorie mit derjenigen des Dekolonialismus des „globalen Südens“ und dem
islamischen Fundamentalismus, wie er auch von der Hamas gepflegt wird, sieht Eva
Illouz eine neue absurde Verbindung innerhalb der Linken. Wie sie erläutert,
gründet sich in Frankreich 1949 die Bewegung gegen Rassismus, Antisemitismus und
für den Frieden MRAP. Aufgrund der sozialen Mobilität der Juden wird die
Diskriminierung aber zunehmend nur von Arabern wahrgenommen. 1970 wird
Antisemitismus aus dem Titel der NGO gestrichen. Ähnliches passiert mit der
Verbindung von Juden, Moslems und Schwarzen in den USA. Neuerdings gebe es auch
eine Verbindung der Ökologie- und Klimabewegung und dem Islamistischen
Fundamentalismus. Vorreiter sei hier Andreas Malm, Klimaforscher und Aktivist
aus Schweden. Damit werde Israel nun auch für die Erderwärmung verantwortlich
gemacht. Das sei umso absurder, als die arabischen Länder die größten
Erdölproduzenten sind und der Zionismus und der Stadt Israel keinerlei
Verbindung zum Erdöl oder zu Kohle aufwiesen. In diesem Zusammenhang agiert auch
Greta Thunberg mit ihren Versuchen, per Segelschiff Proviant nach Gaza zu
bringen.
Denkerischer Kurzschluss und Identitätspolitik
Auch dieser neue
Antisemitismus bleibe damit wie der alte der Trost der dummen Kerle. Illouz
macht am Ende zwei Momente aus, die ihn als neuen, sich nun tugendhaft gebenden
Hass begünstigen: das schnelle Denken einer kognitiven Leichtigkeit, die Juden
nach wie vor für alles Böse verantwortlich zu machen und eine durch bekannte
Erzählstrukturen gestützte Tendenz zur „sozialen Identität“, nämlich feststellen
zu sollen, „was und wer wir sind“. Gruppen und Klassen aber ständen in einem
gesellschaftlichen Kampfverhältnis zueinander. Die Juden entwickelten sich dabei
zu einer dominanten Minderheit, die den Antisemitismus zu einer Aktion des
Protestes gegen die Herrschenden macht. Das hatte alles bereits Siegfried
Bernfeld festgestellt.
Eine notwendige Ergänzung
Illouz führt damit in
ihrem Buch eine Reihe artiger Wahrheiten aus, die sich die Linke gegen den
immerwährenden Hang zum drohenden Antisemitismus ins Stammbuch schreiben sollte.
Sie schließt ihren Text aber im August des Jahres 2024 ab. Übersetzung und
Herausgabe führen dazu, dass der Essay erst mit einem Jahr Verspätung auf
Deutsch erscheint. In diesem Jahr sind die Geiseln immer noch nicht
freigekommen, es hat sich aber der Druck der israelischen Armee und der
israelischen Regierung auf Gaza ungeheuer verstärkt. Die Zahl der zivilen Opfer
ist auf über 60.000 angestiegen. Ist Illouz‘ Parteinahme für Israel weiterhin
gerechtfertigt? Versuchen wir es zunächst mit einer immanenten Kritik. Die
Soziologin will in ihrem Text von 2024 eine marxistische Methode von der „French
Theory“ absetzen. Diese bestünde in einem Dreischritt: Zunächst das Bestehende
zu kritisieren, dann zu sagen, was sei und schließlich die Möglichkeiten dieser
Kritik auch in der verzerrten Ideologie für die Zukunft auszuloten. Illouz‘ Text
selbst bewegt sich allerdings nur innerhalb des ersten Feldes. Sie deutet auf
blinde Flecken der Selbstkritik in der Theorie des sogenannten globalen Südens,
der Dekonstruktion und des postmodernen Denkens insgesamt. Um nun zu dem zu
gelangen, was auch Rosa Luxemburg für das Wesentliche an einer Theorie hält,
nämlich zu sagen, was ist, muss diese sich der anderen Seite der eigenen
Position stellen. In diesem Fall ist das die überzogene Reaktion Netanjahus und
seiner rechtsradikalen Regierung mit Korruption, Klientelpolitik der Siedler und
der Hügeljugend sowie mit Beziehungen zu dem sich selbst immer autoritärer und
erratischer gebärdenden Regime Donald Trumps. Das versäumt Illouz in ihrem Essay
von 2024. Sie beginnt es allerdings anscheinend in einem Interview nachzuholen,
dass sie im September 2025 der Süddeutschen Zeitung gibt. Dort heißt es
nach einer längeren Passage über Moralismus in den USA anlässlich des Todes von
Charlie Kirk nun über ihren eigenen Essay:
»Wir
sollten den Antisemitismus bekämpfen und zugleich Netanjahus Regime und seine
verrückte Regierung, die so viele Menschen, Palästinenser und Juden in Israel,
zur Verzweiflung treibt. Es gibt keine Schwierigkeit, beides gleichzeitig zu
tun, und dennoch hat die Linke zu oft das eine oder das andere gewählt.
Ein dialektisches Denken sollte damit schließlich auch den dritten Schritt
erlauben. Nämlich ein Israel, ohne seine rechtsradikale Regierung ebenso zu
denken wie ein Palästina, das sich von der Hamas befreit.
[1]
Vgl.
Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen (1917/1923). Text von
1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin: Duncker & Humblot
2015.
Artikel online seit 29.09.25
|
Eva Illouz
Der 8. Oktober
(frz. 2024)
Suhrkamp 2025
Aus dem Französischen von Michael Adrian
103 Seiten
12,00 €
978-3-518-47530-0
Leseprobe & Infos
|