|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
||
|
|
||
|
|
Ideen in Manien verwandeln Vor 30 Jahren starb in einer Pariser Demenzstation einerder damals freiesten Geister Europas: Emil Cioran Von Jürgen Große |
|
|
„Alle
Länder, denke ich manchmal, sollten der Schweiz ähnlich sein. Sie sollten wie
diese in Hygiene und Seichtheit, in der Vergötzung der Gesetze und im Kult des
Menschen behaglich erschlaffen. Andrerseits sind nur die von keinen Skrupeln im
Denken und Handeln angekränkelten, die fieberhaft unersättlichen Nationen für
mich anziehend, welche stets bereit sind, die anderen zu verschlingen, sich
selbst zu verzehren und Werte, die ihrem Aufstieg und ihrem Erfolg im Wege sind,
mit Füßen zu treten, verstockt gegen die Weisheit, diesen Krebsschaden der
alten, von sich selbst und vor allem anderen übersättigten und gleichsam vom
Schimmelgeruch behexten Völker.“ I Für ironische Provokation und selbstironische Exaltation stehen die Zeichen derzeit schlecht. Konflikte finden im öffentlichen Raum zwischen korrekt umgrenzten Milieus statt, nicht zwischen widersprechenden Wertungsimpulsen in der eigenen Seele. „Russland und das Virus der Freiheit“, so der Titel des zitierten Essays, ist das zweideutige Lob jenes Machtwillens, der eine Zivilisation materiell und kulturell groß macht, um ihr zuletzt moralisch peinlich zu sein. Für Cioran ein Gesetz der Geschichte, dem nur kleingebliebene Staaten und ehrgeizlose Völker entgingen. Seine Lobpreisungen folgen den Geboten der Ambivalenz, die Cioran am Grunde aller menschlichen Wertungen, auch aller Pathetik findet: Jeder Erfolg richtet sich gegen den Erfolgreichen, jede verwirklichte Utopie ist ihre Widerlegung, jede erfüllte Traum seine eigene Parodie. Dennoch macht Bescheidenheit nicht froh. Ambivalenz ist heute meist ein hilfloses Kompliment, hilfloser noch und häufiger ein Vorwurf. Sie wurde zu Ciorans Weg in Europas dialektische Denktradition, meist in Form der glänzenden, auch blendenden Paradoxie. Synthese und Sublimierung, zwei Haupttrends der klassischen Moderne, hat Cioran abgelehnt. In Thomas Mann wie dessen Vorbild Goethe fand er lange seine „absoluten Unmöglichkeiten“. Erst im Alter glaubte er in Goethe einen gleichfalls philosophisch Resignierten zu erkennen. Ciorans bleibende Stärke liegt in seinem Contra zu einer pervertierten Aufklärung, die darauf hofft, auch noch die affektiven Impulse für Vernunft und Moral dienstbar zu machen, ja, sie passgenau zu züchten – und zuletzt alle aggressiven Affekte sozial zu ächten. Sein seelischer Zwang und literarischer Stil ist es, die unvermeidlich affektive Basis alles Meinens und Wertens schreibend auszuleben, unter Verzicht auf konstruktive Verheißungen. In dieser radikalen Subjektivität wollte er über Nietzsche hinausgehen, der mit seiner Übermenschenidee als Utopist geendet sei, aufgrund einer genuin deutschen Besessenheit, „etwas schaffen zu wollen, etwas zu konstruieren“. So Cioran im Interview mit dem Religionsforscher Klaus-Jürgen Heinrichs: „Vielleicht ist das der Fehler der Deutschen im allgemeinen und auch des deutschen Denkens: Man muss überwinden, man muss konstruieren, man muss aufbauen.“ Sich selbst und andere bezwingen, aber auch: konstruktiv sein, richtig fühlen, nützlich denken – genau diese Obsession lasse die deutsche Geschichte zu einem Scheitern ohnegleichen geraten. Der hier zelebrierte Abschied von Nietzsche und von Deutschland soll nicht zuletzt Ciorans eigene Affäre mit der Politik vergessen machen. Publizistisch hatte er sich in den 1930ern für die Legion Erzengel Michael (später: Eiserne Garde) engagiert, eine radikalnationalistische Gruppierung noch vor Antonescus Regime. Wie hatte es dazu kommen können? II Als Sohn eines orthodoxen Priesters war Cioran 1911 in einer siebenbürgischen Kleinstadt geboren worden, hatte im vielsprachigen Hermannstadt (früh spricht er deutsch) „ganze Bibliotheken verschlungen“ und ein ungebundenes Streunerleben geführt. Er hatte beizeiten – wie die berühmteren Existentialistenkollegen in Paris – das Schwindelgefühl geistiger Freiheit erlebt. Sein juveniler Lobpreis von Fanatismus und Gedankenlosigkeit ist nicht nur Überdruss an der eigenen Hyperreflektiertheit, sondern auch Leiden an der agrarischen Prägung seiner Heimat, nach 1918 war das Großrumänien. Als 23jähriger Literaturdebütant („Auf den Gipfeln der Verzweiflung“, 1934) hofft er auf einen großen Sprung des Landes in die Weltpolitik, ähnlich Lenins Russland und Mussolinis Italien. Nur in einem prosperierenden Staat nämlich lasse sich kompetent am Wert und Sinn des Lebens verzweifeln! Ob Pointe oder Überzeugung: Die liberale Demokratie des Westens, von vielen Altersgenossen bewundert, ist für Cioran keine Option. Namentlich Frankreichs Skeptizismus und Relativismus empfindet er als spätkulturelles Greisentum, ja als persönliche Gefährdung. Denn der junge Studienrat für Philosophie – hochbelesen, überaufgeweckt, dauerschlaflos – fühlt sich geistig bereits sehr alt. Trotzdem geht er 1937 als Stipendiat nach Frankreich, kehrt von dort nie wieder nach Rumänien zurück. Er wechselt die Sprache, entgeht als Exilant der militärischen Dienstpflicht, später auch einer politischen Verfolgung als Ex-Legionär. In Paris lebt Cioran lange Zeit isoliert, in höchst empfindlichem Stolz mit der neuen Sprachumgebung fremdelnd. Seine Freunde findet er unter den, wie er gern sagt: „Verkommenen“, den bürgerlich Gescheiterten, Unberühmten. Der gerade berühmt werdende Sartre hingegen – das sei ein „Schulmeister“, infiziert vom Schlimmsten des deutschen Systemgeistes! Ähnlich Ciorans Antipathie gegen seinen ersten französischen Lektor, einen gewissen Albert Camus – ebenfalls ein Ex-Lehrer, freilich mit anhaltender Lehrambition: „Schön, was Sie da geschrieben haben, aber jetzt müssen Sie in den Kreis der Ideen eintreten!“ Im Tagebuch wütet Cioran: Das wage ihm ein geistiger Provinzler zu sagen, beschränkt auf die französische Literaturtradition! Cioran, der große Leser, hatte ein anderes Verhältnis zur geistigen Überlieferung, die auch den Orient und dessen Religionen einschloss. Das endlos Für und Wider überlieferter Ideen und die daraus erwachsende Skepsis bedeutete Cioran nicht philosophischen Skandal, sondern eine Normalität menschlichen Gefühlslebens, was jeder Ehrliche an sich selbst beobachten könne. Cioran fand in dieser Ehrlichkeit seine schriftstellerische Mission, „ganz das Gegenteil einer Mission“, wie er einräumte. Den pseudo-objektiven, sublimierenden Stil der Philosophieprofis stellt er auf den Kopf. Der Rumäne will statt dessen „Ideen in Manien verwandeln“, ja, sich „der Mythologien und der Theologien für indirekte Vertraulichkeiten“ bedienen. Sein „von tausend Zweifeln“ geplagtes Inneres macht er zum Schlachtfeld widerstreitender Geistestendenzen Europas. Dessen riskante Neigung, in seiner Philosophie eine selbstmörderische, zumindest entmutigende Selbstbefragung zu erzeugen, ist Dauerthema Ciorans. Sein Trostwert auch für die reifere Jugend beruht auf literarischer Transformation durchaus konkreter Probleme in metaphysische, angesichts deren Unlösbarkeit man aufatmen könne: Cioran übertreibt maßlos und doch kalkuliert, scheut nicht vor dem Ruf der Lächerlichkeit zurück und entgeht ihr dadurch. Wie bei allen Denkern von Format gibt es keinen Einwand, den er sich nicht selbst gemacht hätte.
III Zuerst hatte Cioran es mit Zynismus versucht. Das wurde zu seinem 100. Geburtstag medienöffentlich. 2011 hatte Suhrkamp, Flagschiff der aufgeklärten BRD-Intelligentsia, Ciorans Berlin Korrespondenzen von 1933/34 auf den Markt geworfen. In ihnen porträtiert Cioran fanatische Hitler-Anhänger, preist zweideutig ihre individuelle Gedankenarmut als nationalkollektive Tatkraft. Ein Stil, den Cioran ähnlich in seinem Pamphlet „Rumänien mit gewandeltem Angesicht“ (1936) anwandte. Mehr als um intellektuelle Ermächtigung einer Diktatur geht es um das Selbstgefühl des Ermächtigers: Cioran sucht den Eindruck zu erwecken, er plaudere ungerührt aus dem Nähkästchen der Macht. Die intellektuelle Überbietung dessen, was ihm politisch unvermeidlich scheint, wird zur frivolen Affirmation nahe der Pose, ja der Posse. Als frankophoner Autor fühlt sich Cioran dann im Zentrum abendländischer Dekadenz. Politische und psychologische Innenschau, dazu der moralische Universalismus des Westens sind Themen seines Erstlings bei Gallimard („Lehre vom Zerfall“, 1949). Sie provozieren ihn bis ans Lebensende. Die Freundin Susan Sontag erkannte in Cioran einen jener Denker, die im Persönlichen ihren Reflexionszwang mit Märtyrerstolz tragen, ihn im Gesellschaftlichen jedoch als Niedergang beklagen. Die Segnungen der liberalen Demokratie konnte Cioran nur ironisch anerkennen. So in diesem Trostbrief „An einen fernen Freund“ (1957), der sich aus seiner östlichen Diktatur fortsehnt in westliche Freiheit: „Nein, so verderbenbringend ist sie gar nicht, diese Gesellschaft, die sich nicht mit einem beschäftigt, die einen sich selbst überlässt, einem das Recht garantiert, sie anzugreifen, einen sogar dazu auffordert, ja verpflichtet, in ihren faulen Stunden, wenn sie nicht genug Energie hat, um sich selbst zu beschimpfen.“ Der Intellektuelle als Exekutor westlichen Selbsthasses! Doch seinen Zynismus wollte Cioran stets als intellektuelle, nicht als existentielle Haltung verstanden wissen. Das versuchte er so eindringlich wie vergebens seinem Briefpartner Fritz J. Raddatz klarzumachen, der als gut bundesdeutscher Literaturmoralist sich noch postum über den Interviewten empörte. Der außerliterarische Cioran war mitfühlend und hilfsbereit. Für bedürftige Verwandte in der Heimat sammelte er Kleidung und Schuhe, selbst noch als Pariser Berühmtheit – die fast alle Preise ausschlug. Ein cholerischer Melancholiker, der viel lachte, der in seinen Tagebüchern von der Angst schrieb, zu verletzen oder verletzt zu werden, und der von seinem Werk sagte: „Ich habe in meine Bücher das Schlimmste meiner selbst hineingelegt. Zum Glück, denn wieviel Gift hätte ich sonst angehäuft! Meine Bücher strotzen von Gehässigkeit, mörderischen Launen, Rachsucht – aber das war vielleicht nötig, denn sonst hätte ich nicht einen gewissen Anschein von Ausgeglichenheit, von ‚Vernunft’ wahren können.“Artikel online seit 19.06.25 |
|
|
|
|
||
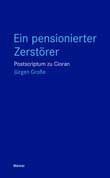 Jürgen
Jürgen Jürgen
Jürgen E.
M. Cioran
E.
M. Cioran