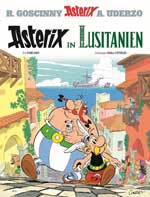|
Der neue Asterix-Band,
der mittlerweile überall zu haben ist, spielt in Portugal, also der Provinz
Lusitanien des römischen Reiches. Das war eines der wenigen Länder der römischen
Welt, welches die Gallier noch nicht bereist hatten. Das neue Produktionsteam
der Hefte besteht aus den Textern, Zeichnern und Übersetzern Fabrice Caro,
Didier Conrad, Thierry Mébarki, Klaus Jöken und vielen anderen. Es hat nach dem
Tod von René Goscinny 1977 und Albert Uderzo 2020 eine schwere Bürde – gleichsam
einen eigenen Hinkelstein – zu tragen. Denn es folgt nicht eigenen
schöpferischen Einfällen, sondern die sogenannten Kreativen müssen ihre Ideen in
dem Dispositiv unterbringen, das die Marke Asterix Ihnen zuweist.
Das mag für moderne Verhältnisse, die einem expressionistischen Kunstbegriff und
damit einer Vorstellung von Authentizität für den Künstler folgt, schwierig
sein. Zum Glück gibt es aber bereits seit der Frühzeit der Moderne populäre
Mischformen wie die Karikatur oder später die Produkte des Dadaismus und des
Surrealismus, die weiter mit dem Kitsch einer übertriebenen und parodistischen
Form spielen. Marshall McLuhan wies überdies 1951 in seinem Buch Die
mechanische Braut darauf hin, dass die Tradition der amerikanischen
Zivilisation in der Populärkultur und damit in den Autos von Chevrolet und den
Comics von Superman wurzelt.
In einer solchen Übergangsform von Kunst und Design und hoher und niederer
Kultur sind auch die Asterix-Hefte angesiedelt. Ihr Witz lebt davon, Elemente
der griechischen und römischen Antike den „Barbaren als Kulturhelden“ (Bazon
Brock) gegenüberzustellen. André Stoll hat auf den Spuren von Umberto Eco und
Roland Barthes frühzeitig die Zeichen und Codes des Comics aus Frankreich
hinreichend analysiert.
Was den Witz angeht, der sich aus einer Varianz von sich wiederholenden
Elementen speist, so hat Henri Bergson bereits im Jahre 1900 in seinem Buch
Das Lachen das Wichtigste darüber ausgeführt. Der französische
Lebensphilosoph erläutert den Effekt aus der Erwartung der Zuschauer von etwas
Lebendigem, an dessen Stelle dann eine mechanische Reaktion tritt. Ebenso spielt
umgekehrt ein Sinn für Humor eine Rolle, der sich nicht über eine einfache
Wiederholung, sondern über eine kluge Anpassung an neue Verhältnisse freut.
Das ist der Grund, warum auch zum 100. Mal bei Asterix darüber gelacht wird,
wenn die Römer verprügelt und die Piraten versenkt werden. Und auch, wenn Obelix
gerne einen Schluck Zaubertrank haben möchte oder – wie in der Geschichte des
neuesten Heftes – die Mosaiksteine, die man in Lissabon als Straßenpflaster
findet, zu einem Hinkelstein aufschichtet. Andere mehr oder weniger
liebgewordene Klischees werden hier natürlich auch auf die eine oder andere
Weise mechanisch wiederholt. Aber es gelingt den neuen Autoren, die clichés,
die im Französischen Abklatsch bedeuten, jeweils in eine neue und
aktuelle Situation zu bringen, sodass das Motiv sich damit nicht nur ermüdend
wiederholt, sondern es sich in einem gewissen Rahmen auch verjüngt.
Die Anwendung von Regeln aus der Tradition auf neue Situationen ohne
Wiederholung ist selbst eine Kunst. Wir finden Sie bereits im antiken Japan im
Kopfkissenbuch der Dame Sei Shonagon (ca.
966-1010).
In Europa entsteht die Idee eines authentischen Neuen im 19. Jahrhundert, der
Begriff jedenfalls fällt erst bei Heinrich Heine und Charles Baudelaire als
Gegensatz zur Antike. Noch in der Barockzeit galt das Ideal einer Verschaltung
von traditionsreichen Mimes in Varianten als Inbegriff der Bildung. Das Neue
entstand also zunächst aus der Differenz der Zusammensetzung des Alten. In
gewisser Weise knüpfen die Praktiken der Comic-Produktion, bei der etablierte
Serien wie Lucky Luke, Spirou oder eben Asterix von jungen
Leuten weitergeführt werden, an diese vormoderne Tradition an, die in der
Postmoderne als Kritik an großen Systemen (Lyotard) wieder aufgenommen wird. Das
anzuschauen, macht umso mehr Freude als die letzten Alben, die der Zeichner
Albert Uderzo (1927-2020) ohne seinen Texter René Goscinny nach dessen Tod
herausgebracht hatte, deutlich machte, wer der Kopf und wer die Hand des
Unternehmens Asterix gewesen ist. Die Produktion eines Comics beschäftigt
mittlerweile fast so viele Menschen wie ein Film. Man benötigt Geldgeber, eine
Strategie im Großen wie im Kleinen und viele Regeln aus der Filmproduktion
gelten auch hier. Andreas Platthaus beispielsweise hat das Medium des Comics als
Proto- und Postform des Films oft genug dargestellt.
Auf diese Weise auch intellektuell gerüstet, um die gleichsam unreine Form des
Comics gegenüber einem puristischen Kunsturteil genügend verteidigt zu haben,
macht die Lektüre des neuen Asterix-Heftes umso mehr Spaß. Und man vermag die
Witze, die sich hier als konkrete Poesie in den Sprechblasen als Namen und in
den Wimmelbildern als humoreske kleine Handlungen abspielen, zu würdigen. Auch
in den größer angelegten Panoramabildern, die oftmals eine halbe Seite
einnehmen, erkennt man – Asterix auf Korsika lässt grüßen – Motive der
schönen portugiesischen Natur als Steilküste im Norden und als Städtebild von
Lissabon, dass hier noch Olispo heißt. Die Logik der Figurenzeichnung folgt
natürlich den Nationalklischees von den kleinen und freundlichen portugiesischen
Männern und den schönen Frauen, in der Empirie oft mit Damenbart. Männlein wie
Weiblein aber sind allesamt den klagenden Kunstformen verpflichtet. Hier hört
man nicht nur den Fado als traurige Ballade im Hintergrund, sondern auch die
berühmte portugiesische Melancholie als saudade, als unstillbare
Sehnsucht nach dem Meer und dem Tod.
Der Plot soll hier ausnahmsweise nicht verraten werden. Der Kritiker ist
ansonsten ein großer Anhänger der Brecht’schen Theorie, wonach das Ende immer in
einer Kritik ausgeplaudert werden muss, um die Darstellung umso besser würdigen
zu können. Aber so viel sei immerhin verraten, dass dieses Ende sich um
einheimische Produkte dreht. Und um gallische Landsleute als Parodie auf die
scharenweise in Portugal in Wohnmobilen überwinternden Rentner aus den
nördlichen Ländern Europas wie Frankreich und Deutschland, mit deren Hilfe
diesmal die Römer besiegt werden. Gelungen ist auch der Coup, wonach Asterix und
Obelix sich als Portugiesen verkleiden. Wobei das dann allerdings ähnlich
aussieht, wie wenn in einer Star Trek-Folge der Landungstrupp sich
genetischen Veränderung unterwirft, um als Klingonen durchzugehen oder um nicht
gegen die Erste Direktive zu verstoßen. Bei Star-Trek ist das eine
Hommage an die Maske, auf der die Hauptlast der Filme ruht. So hängt in der
Populärkultur eben alles mit allem zusammen.
Hingewiesen sei noch auf den Sprachwitz, der die Eigenart des Portugiesischen,
Substantive auf – ção zu bilden, vielfach aufnimmt. So heißt eine
Pferdetankstelle beispielsweise Essão oder es ist in den Sprechblasen von
Gefühlen als „Welche Emoção!“ die Rede. Dem Verdikt einer übermäßigen
Sexualisierung der Frauendarstellung im Comic – aufgrund dessen ein Heft der
Spirou-Reihe unlängst zurückgezogen werden musste – fällt die
Asterix-Gruppen nicht anheim. Es gibt zwar bei der Darstellung der Orgie, die
Caesar auf einem Schiff im Hafen unter dem Fackelschein des Torre de Belem (nach
dem auch die portugiesischen Vanilletörtchen benannt sind) veranstaltet, eine
Tanzgruppe. Die Tänzerinnen tragen zwar knappe weiße Kostüme wie Marilyn Monroe
im Film Das Verflixte 7. Jahr, diese Szene erinnert aber doch eher an den
biederen Friedrichstraßenpalast in Berlin als an das Moulin Rouge in Paris.
Insgesamt handelt sich bei dem Album also um eine durchaus gelungene Mischung
aus Altem und Neuem, wenn auch nicht das Verhältnis erreicht ist, was der
Bauhaus-Lehrer Lazlo Moholy-Nagy seinen Studenten empfohlen hat. Dessen
Wahlspruch lautet bekanntlich: Nicht zu viel Neues, damit die Betrachter nicht
überfordert werden. Das gilt auch für Asterix in Lusitanien. Asterix war
zwar noch nie ein Hort der Aufklärung und man sollte auch seine entsprechenden
Hoffnungen dämpfen. Über den Titel aber darf sich der Kritiker als Lusitanist
(also als ein Romanist, der sich mit der Sprache und Kultur Portugals
beschäftigt) dennoch freuen!
Artikel online seit 18.11.25
|
Fabcaro, Didier Conrad
Asterix in Lusitanien
Band 41
Egmont 2025.
|