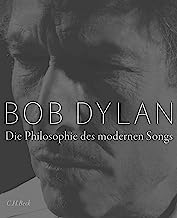|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |
|||
|
Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |
|||
|
|
|||
|
|
Der »song and
dance man«
|
||
|
Als Bob Dylan auf der legendären Pressekonferenz am 3. Dezember 1965 in den KQED Studios in San Francisco auf die Journalistenfrage Do you think of yourself primarily as a singer or a poet? antwortete Oh, I think of myself more as a song and dance man, you know, deutete das Gelächter, das daraufhin im Raum ausbrach, daraufhin, dass kaum einer der Anwesenden davon ausging, dass er seine Antwort ernst gemeint haben könnte. Aber genau das war der Fall. Aus der pointierten Formulierung entstand für ihn eine Art unbewußter Verpflichtung, sich zu dem song and dance man zu entwickeln, als der er sich positioniert hatte. Während die Frage des Journalisten sich zwischen den Alternativen von Autor und ausführendem Künstler sowie hoher und populärer Kultur bewegt, hebt Dylan diese Kompetenzschranken auf und verschiebt seine Position in den sozialen Raum. Er ist jemand, der durchs Land zieht, um die Menschen zu unterhalten. Zugleich stellt er sich in eine Tradition, die von den mittelalterlichen Spielleuten bis zu den amerikanischen song an dance men des 20. Jahrhunderts reicht. Das ist die Position, die er seitdem nicht mehr aufgegeben, durch sein 1988 einsetzendes Tourleben und seine Rolle als Host der Theme Time Radio Hour zwischen Mai 2006 bis 2009 gefestigt hat, und aus der er auch seine Philosophy of Modern Song entwirft. Als er von Jeff Slate vom Wall Street Journal gefagt wurde, was ihn zu seinem Buch inspiriert und welche Bücher über Songwriting und Musikgeschichte er gelesen habe, nannte Dylan Arnold Shaws Geschichte des Rhythm and Blues »Honkers and Shouters«, »Dino«, die Dean Martin-Biographie von Nick Tosches, Bücher über Elvis von Peter Guralnick, womit die beiden Bände »Last Train to Memphis« und »Careless Love« gemeint sein dürften, in denen der Aufstieg und Abstieg von Elvis Presley beschrieben wird, und some others, auf die er nicht näher einging, um dem hinzuzufügen: But The Philosophy of Modern Song is more of a state of mind than any of those. Als der Band in der ausgezeichneten Übersetzung von Conny Lösch im November 2022 erschienen ist, die für den Dylan sound einen unangestrengten, bedeutungsäquivalenten Ton findet, erhielt er fast ausnahmslos freundliche Besprechungen sowie einen Totalverriss von Willi Winkler in der »Süddeutschen Zeitung«. Beide Haltungen sind von Fehldeutungen und Missverständnissen nicht frei, wie zum Beispiel im Hinblick auf den Titel des Bandes, der als genitivus subiectivus zu verstehen ist. Dylan erhebt nicht den Anspruch, anhand ausgewählter Beispiele über den modernen Song zu philosophieren; seine Überlegungen verstehen sich als Versuche, den Gehalt freizusetzen, der den Songs eingezeichnet ist. Und diesen Gehalt bezeichnet er als die Philosophie des modernen Songs. Martin Lüdke gewann dem Buch in seiner Würdigung in der Online-Kulturzeitschrift »Faust-Kultur« persönliche Reminiszenzen an seine Zeit als Jugendlicher in der DDR ab, in der er mit einem selbstgebauten Detektorempfänger heimlich die von AFN, dem Hörfunksender der US-amerikanischen Streitkräfte, verbreitete Country-Music hörte. Was ihn von seinen Kritikerkollegen unterscheidet, ist die Einsicht, dass die Rezeptionsbedingungen das entscheidende Konstitutionsprinzip von Dylans Philosophie des modernen Songs sind. Nur bei der Behauptung, Johnny Paycheck sei ein kleiner Mann, kaum größer als einsfünfundfünfzig gewesen, ist er dem song and dance man auf den Leim gegangen. Johnny Paycheck, war 1,65 m. In seiner Philosophie des modernen Songs lässt Dylan 66 Songs, die zwischen 1924 und 2004 aufgenommen wurden, Revue passieren, die er als Hörer im Radio oder auf analogen und digitalen Tonträgern vernommen hat. 55 dieser Songs sind zwischen 1950 und 1979, von »Poison Love« (1950) von Johnnie And Jack bis zu »London Calling« (1979) von The Clash, produziert worden, davon 28 in den 1950er Jahren. Die meisten Texte beginnen mit einer atmosphärischen Anverwandlung aus Nacherzählung und Einfühlung, wie Harry Nutt in der Frankfurter Rundschau geschrieben hat, an die sich in einer an den Radio DJ gemahnenden anekdotischer Form, Informationen zu den Songs, ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund und lebensgeschichtlichen Details der beteiligten Musiker anschließen. Ergänzt werden die Textbeiträge durch rund 150 Abbildungen, in denen der politisch-soziale Raum sichtbar wird, in dem der moderne Song seine eigentümliche Bedeutung gewinnt. Und schließlich ist dem Band eine Widmung an Doc Pomus vorangestellt, die sich als Hinweis verstehen lässt, wie er zu lesen sei, nämlich als ein Dokument der Hingabe an den modernen Song. Pomus' größter Hit, den der in seiner Kindheit an Polio erkrankte Sänger und Komponist gemeinsam mit Mort Shuman schrieb, war Save the last dance for me für die Drifters. Der Songeinfall geht auf seine Hochzeit im Jahre 1957 zurück, bei der er, der zeitlebens auf einen Rollstuhl und Krücken angewiesen war, zusah, wie seine Braut Willi Burke, eine erfolgreiche Schauspielerin und Tänzerin am Broadway, mit den Hochzeitsgästen über die Tanzfläche wirbelte. But don't forget who's takin' you home/ And in whose arms you're gonna be/ So darling, save the last dance for me. Neben der Dedikation an Pomus enthält die Widmung eine Dankadresse an mehrere Personen, wobei an erster Stelle der Anglerfreund Eddie Gorodetsky genannt wird, und zwar für Input und ausgezeichnetes Quellenmaterial. Bei dem Anglerfreund handelt es sich um den Drehbuchautor und Fernsehproduzenten, der Dylans Theme Time Radio Hour produziert und ihm dafür seine umfangreiche Musiksammlung zur Verfügung gestellt hat. Es ist also naheliegend, das Buch, an dem er nach Auskunft seines Verlages seit 2010 geschrieben hat, mit der Theme Time Radio Hour in Verbindung zu bringen, zumal in einigen Texten Songlisten zu bestimmten Themen zitiert werden und auch der Ton, in dem er die Geschichten zu den Songs liefert, an den des Radiomoderators erinnert. Gleichwohl ist der Band mehr als das nachgereichte Printprodukt zur Sendereihe. Denn er zeigt, nicht zuletzt durch das beigegebene Bildmaterial, wie der Rundfunk, die Aufnahmestudios und die Plattenfirmen dem modernen Song seine kanonische Form verliehen und ihn zum Bestandteil der Kultur- und Bewußtseinsindustrie des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Bei den Songs, mit denen er sich auseinandersetzt, handelt es sich weder um Dylans Lieblingssongs noch um solche, die ihn in seiner musikalischen Entwicklung entscheidend geprägt haben, wie in einigen Kritiken zu lesen war. Ganz im Gegenteil gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass er der Kontingenz breiten Raum gibt, dass alles auch anders sein könnte. Häufig bringt er, während er über einen Song schreibt, andere Interpreten des gleichen Songs oder andere Songs des gleichen Interpreten ins Spiel. Das alles kann aber nicht erklären, warum er bei seiner Auswahl mit Cher, Rosemary Clooney, Judy Garland und Nina Simone insgesamt lediglich vier Sängerinnen berücksichtigt. Die modernen Songs, von denen in Dylans Buch die Rede ist, besitzen einen eigentümlichen Doppelcharakter. Einerseits sind sie Teil eines Überlieferungsgeschehens, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermitteln (Hans-Georg Gadamer), andererseits sind sie Produkte der modernen Warenwelt. Warencharakter haben sie nach der Erfindung der Schallplatte, des Plattenspielers und der Entwicklung des Radios durch ihre technische Reproduzierbarkeit angenommen, die dem leidenschaftlichen Anliegen der Massen entgegenkommt, die Dinge sich räumlich und menschlich näherzubringen (Walter Benjamin). Der Produkt- und Warencharakter des modernen Songs wird nicht nur im Bildteil des Bandes durch fünfzehn Fotos hervorgehoben, auf denen Schallplattenläden, Momentaufnahmen vom Produktionsprozess und Plattencover zu sehen sind. Auch in den Kapitelüberschriften werden nicht nur die Songs, ihre Interpreten und die Songwriter, sondern auch die Plattenfirma und das Jahr der Veröffentlichung genannt. Bei zwei Songs, die unveröffentlicht geblieben sind, gar nur die Plattenfirma und das Aufnahmedatum genannt. Entscheidend ist also die Aufzeichnung im Studio, die den Song zum Produkt macht, das beliebig oft reproduziert werden kann. Dylans Songverstehen, diesen glücklich gewählten Ausdruck übernehme ich an dieser Stelle vom Frankfurter Musikjournalisten Michael Behrendt, oszilliert zwischen beiden Polen. Er fühlt sich der weit ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Tradition des Songwritings verbunden, ohne zu verkennen, dass es die technischen Möglichkeiten der Aufnahmestudios und Rundfunkstationen gewesen sind, die dem modernen Song erst seine Geltung verschafft haben. Davon wird die Sprache affiziert, mit der Dylan die Wirkung, die Songs auslösen können, zu beschreiben versucht. Manchmal erscheinen sie als Augenblicksgötter, größer als das Leben selbst, dann wieder als Handlanger für Augenblickserfüllungen. Das Vokabular und die sprachlichen Wendungen, mit denen er die Songlyrics paraphrasiert, sind die des song and dance man, der sich in der Gesellschaft von Huren, Spielern und Mördern aufhält, mit Betrügern, Anwälten und Politkern herumschlägt, seine Zeit unterwegs, in billigen Absteigen und zwielichtigen Spelunken verbringt. Der abschätzige Blick, mit dem er seine Zeitgenossen mustert, ähnelt dem des Schnüfflers, des Typus des Privatdetektivs aus den Romanen von Raymond Chandler und Dashiell Hammett. Einer, dem keine Schwäche der Leute, mit denen er es zu tun hat, entgeht; einer, der sich nichts mehr vormachen und erst recht nichts gefallen lässt. Das Überlieferungsgeschehen, das er durch seine Assoziationen in Gang zu setzen versucht, gleicht einem breiten Strom, der auch viel Geröll mit sich führt. Dann erscheint Dylan selbst als der Gestrauchelte, von dem im Kapitel über den Song »Dirty Life And Times« von Warren Zevon die Rede ist, der den anderen mehr erzählt, als sie wissen wollen. Aber gelegentlich stößt der Leser auch auf sprachliche Minimalismen, die an seine Songlyrics erinnern, und ihm gelingen kleine Epiphanien, wie zum Beispiel in dem Kapitel, das »Blue Suede Shoes« von Carl Perkins gewidmet ist. Diese Schuhe sind mächtig. Sie können in die Zukunft schauen, verlorene Gegenstände lokalisieren, Krankheiten kurieren, Verbrecher identifizieren, all das und mehr, aber wenn es darum geht, dass einer sie anfassen will, ist bei mir eine Grenze erreicht. (…) Diese Schuhe sind nicht wie andere komplizierte Sachen, die kaputtgehen, sich verändern oder transformieren. Sie symbolisieren die Kirche und den Staat, sie bergen die Gesamtheit des Universums in sich, für mich gibt es nichts Besseres als meine Schuhe. (…) Sie rühren sich nicht und sprechen nicht, vibrieren aber vor lauter Leben und enthalten die unendliche Kraft der Sonne. Sie sind so gut wie der Tag, an dem ich sie fand. Dylans »Philosophie des modernen Songs« lässt sich nicht nur als Emanation seiner »Theme Time Radio Hour« verstehen, sondern auch als der rezeptionsästhetische Gegenentwurf zu den produktionsästhetischen Überlegungen, die sich seinen »Chronicles« entnehmen lassen. Während er dort ausgeführt hat, dass sein eigenes Songwriting auf unbewussten Prozessen beruht, die durch bestimmte Lektüreformen in Gang gesetzt werden, thematisiert er hier auf eigenwillige Art, welche Assoziationen die Songs anderer Künstler in ihm auslösen und wie sie sein musikalisches Verständnis erweitert haben.
Neben den Songs,
die er im Radio hörte, hatte Dylan, wie er in den »Chronicles« schreibt, seit
seiner Kindheit das Geläute von Kirchenglocken und das monotone Geräusch
vorüberrollender Güterzüge im Ohr, die beiden Taktgeber in einem Land, das
ebensosehr durch die Pilgrim Fathers wie durch den Frontier Mythos geprägt
worden ist. Gemeinsam bilden sie die mythische Schicht, zu der er einen
originären Zugang gewinnen musste, um seine eigenen Songs schreiben zu können.
Seine Fähigkeit, sich traditionals und ältere Songs anzueignen und zu eigenen
Songs zu machen, ergänzte er durch Streifzüge durch öffentliche Bibliotheken und
die Bibliotheken seiner Freunde, wo er stets auf der Suche nach Geschichten war,
die er zum Gegenstand eines Songs machen konnte. Den Weg zum eigenen Songwriting
beschreibt er als mühsamen, schleichenden Prozess: Man sieht die Songs nicht
kommen und bittet sie zur Tür herein. So simpel ist das nicht. Man will Songs
schreiben, die größer sind als das Leben. Man will berichten, was einem
Seltsames zugestoßen ist, was man Seltsames gesehen hat. Man braucht Wissen und
Verständnis und muß über die Alltagssprache hinauswachsen. Die eiskalte
Präzision, mit der die Altmeister in ihren Songs zu Werke gingen, war keine
Kleinigkeit. Manchmal hört man ein Lied und gerät auf völlig andere Gedanken.
Mehr noch als Ausdruck seiner Unzeitgemäßheit sind Dylans songwriting und seine künstlerische Gesamterscheinung Ausdruck seiner Amerikanizität, er ist mehr als jeder andere Künstler seiner Zeit the american artist schlechthin. In seinem grundlegenden Werk »Bob Dylan In America« hat Sean Wilentz diesen Gedanken mit den Worten zusammengefasst, Dylan sei nicht einfach jemand der – oder dessen Kunst – aus den Vereinigten Staaten kommt, sondern jemand, der so tief wie nur je ein amerikanischer Künstler in seiner Heimat geschürft hat. Dieser Grundzug, der inzwischen zum bevorzugten Paradigma unter den Dylanologen geworden ist, bestimmt sein Spätwerk, insbesondere seine Veröffentlichungen eigener Interpretationen von Songs aus dem Great American Songbook auf den drei Alben »Shadows in the Night« (2015), »Fallen Angels« (2016) und »Triplicate« (2017) und auch seine »Philosophy of Modern Song«. Die Zerrissenheit und Gewalttätigkeit, die in Dylans Paraphrasen der Songs ihren Ausdruck findet, verdankt sich weniger privaten Obsessionen, sondern berührt Dinge, die in dem Land jederzeit unter der Oberfläche hervorbrechen können, das das höchste Bruttoinlandsprodukt (25,5 Billionen US-$) und die höchste Staatsverschuldung (31 Billionen US-$), die meisten Milliardäre (955) und die meisten Nobelpreisträger (400) besitzt, in dem sich die meisten Massenschießereien (647 im Jahr 2022) ereignen und mehr Schußwaffen (ca. 390 Millionen) im Umlauf sind als es Einwohner gibt. Dylans eingentümliche Diktion, die sich zwischen differenzierten Beobachtungen und einer saloppen von sprachlichen Stereotypien durchsetzten Ausdrucksweise bewegt, versucht die Summe dieser Widersprüche in einen kohärenten sprachlichen Zusammenhang zu bringen. Zugleich mag sie mit seiner Vorstellung vom Adressaten seines Buches zusammenhängen. Als ihn Bill Flanagan anläßlich der Veröffentlichung des Albums »Triplicate« im März 2017 fragte, ob er sich darüber Gedanken mache, was Bob Dylan Fans von den für das Album eingesungenen Standards hielten, antwortete er: These songs are meant for the man on the street, the common man, the everyday person. Maybe that is a Bob Dylan fan, maybe not, I don’t know. Nicht nur für amerikanische Ohren lässt sich die Erwähnung des common man nicht von Aaron Coplands 1942 geschriebenem Musikstück »Fanfare for the Common Man« trennen, das auf die berühmte Rede des amerikanischen Vizepräsidenten Henry A. Wallace zurückgeht, die er anlässlich des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten am 8. Mai 1942 gehalten und in dem er das Jahrhundert des Normalbürgers (The Century of the Common Man) proklamiert hat. Dort heißt es: »As we begin the final stages of this fight to the death between the free world and the slave world, it is worth while to refresh our minds about the march of freedom for the common man. The idea of freedom — the freedom that we in the United States know and love so well — is derived from the Bible with its extraordinary emphasis on the dignity of the individual. Democracy is the only true political expression of Christianity.« Es wäre zu einfach zu behaupten, dass sich Dylan den Inhalt dieser Zeilen vollständig zu eigen gemacht hat. Und auch ein Irrtum, dass uns das Pathos dieser Zeilen noch unmittelbar zugänglich ist. Aber einige Bezüge, die in ihnen angesprochen sind, sind auch in Dylans Songs und in dem nun vorliegenden Band präsent. Beides sind Momentaufnahmen mit einer Belichtungszeit von mehr als achtzig Jahren und ihr Adressat ist the common man, dem gewissermaßen vorübergehend das Erbe des Subjekts der menschlichen Gattungsgeschichte zugefallen ist.
Dylans
Philosophie des modernen Songs besteht nicht darin, die Entstehung, die
Funktionsweise und Bedeutung des modernen Songs zu beschreiben oder gar zu
erklären, sondern die Magie, die entsteht, wenn sich die lyrics eines Songs mit
einer Melodie verbinden, mit seinen Reflexionen beständig zu umkreisen.
Zusätzlich erworbene Kenntnisse tragen aus seiner Sicht nichts dazu bei, die
Geheimnisse, von denen die Musik umgeben ist, zu entwirren. Songverstehen ist
eine Verständnisweise, die dem diskursiven Verständnis, das die
Kommunikationsprozesse unseres Alltags bestimmt, geradezu entgegen gesetzt
ist. Wie jedes andere Kunstwerk, heißt es im Kapitel über den Song »Don't Let Me
Be Misunderstood«, strebten auch Songs nicht danach verstanden zu werden.
Kunst
kann man schätzen oder interpretieren, aber nur ganz selten gibt es dabei etwas
zu verstehen. Das entscheidende Merkmal des modernen Songs besteht demnach nicht
in seinem Mitteilungscharakter, sondern darin, dass er Teil des menschlichen
Ausdrucksverhaltens ist. Er enthält keine Botschaft, die zu entschlüsseln wäre.
Dennoch kann er auf jeden von uns seine Macht ausüben, solange noch unser
schwaches mimetisches Vermögen in uns lebendig ist. |
Bob
Dylan
|
||
|
|
|||