|
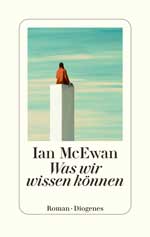 Kultur
verschwindet Kultur
verschwindet
Im Jahr 2014 trägt der Dichter Francis Blundy bei einem Abendessen mit engen
Freunden zu Ehren seiner Frau Vivien ein Gedicht vor. Niemand am Tisch ahnte
damals, daß dieses Gedicht noch Generationen später Grund für Spekulationen
liefen würde. Das Problem bei der Sache: Es gab nur eine einzige Niederschrift
und die ist verschwunden und bislang unauffindbar.
Gut einhundert Jahre später 2119 ist die Welt zum Großteil überschwemmt, Europa eine
unwegsam gewordene Insellandschaft geworden.
Der Literaturwissenschaftler
Thomas Metcalfe hat sich auf die Suche nach dem von Gerüchten umrankten
»Sonettenkranz für Vivien« gemacht. In all den Spuren, die das berühmte Paar hinterlassen hat, stößt
Thomas bei seinen Recherchen auf eine geheime Liebe, aber auch auf ein Verbrechen.
Und was macht die Suche nach einem Text, dessen Inhalt nicht einmal bekannt ist,
mit ihm selbst. Ian McEwan hat ein komplexes Szenario realen und literarischen
Geschehens in einer fragilen, zukünftigen Welt entworfen, in dem es um nichts
weniger geht als die Frage, wie Kultur verschwindet und wie aus den
Fragmenten vergangenen Geschehens etwas
Beständiges für die Zukunft gesichert werden kann.
Ian McEwan - Was wir wissen können - Aus dem
Englischen von Bernhard Robben - Diogenes - Hardcover Leinen - 480 Seiten -
28,00 € - 978-3-257-07357-7
Leseprobe
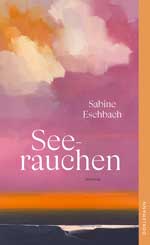 Stimmen
und Farben Stimmen
und Farben
»Sein erstes Wort sprach Josef mir sieben Jahren.« Es war eines jener
gefährlichen grünen Wörter: »Idiot.«
In ihrem gelungenen Romandebut »Seerauchen« erzählt Sabine Eschbach einfühlsam
und poetisch von der Farbenpracht einer besonderen Weltwahrnehmung und auch von
den Gefahren des Andersseins.
Es ist schon eine ganze Weile her, daß mich ein Romananfang so intensiv in ein
Buch gezogen hat.
In den Roman »Seerauchen« von Sabine Eschbach. Er spielt am Bodensee in den
30iger Jahren, und sein Held heißt Josef. Wir ahnen es schon, Josef ist anders,
und unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ist Anderssein gefährlich –
lebensgefährlich.
Geräusche und Stimmen füllen seinen Kopf mit Farben, kleinste Veränderungen in
seinem Alltag, verunsichern ihn. Nach heutigem Verständnis würde man ihn dem
Autismus-Spektrum zuordnen. Als Josef endlich zur Schule gehen darf, scheint
sich sein sehnlichster Wunsch zu erfüllen: Dazugehören. Unter der fördernden
Obhut des Lehrers entfaltet er seine besonderen Begabungen.
Über die Jahre jedoch macht sich die NS-Diktatur auch in seinem entlegenen Dorf
bemerkbar, und das Gift der Propaganda beginnt zu wirken. Der Hass auf Josef
wächst, seine wenigen Vertrauten beginnen zu verschwinden, und Josef muss sich
entscheiden.
Sabine Eschbach - Seerauchen - Roman -
Dörlemann Verlag - 352 Seiten 25,00 €
978-3-03820-172-4
 Liebe,
Krieg und die Geburt
Liebe,
Krieg und die Geburt
des Impressionismus
1870/71 ist Paris im Aufruhr. Während auf den Straßen der Hauptstadt die
Monarchie ihren Geist aushaucht, wird die Kommune blutig niedergeschlagen eine bürgerliche Regierung etabliert
wird, sitzt die junge Berthe Morisot dem
Maler Édouard Manet Modell und findet nach und nach zu ihrem eigenen,
unverwechselbaren Malstil. Zusammen mit ihren Familien sind die beiden einige
der wenigen impressionistischen Künstler, die während des Schreckensjahres in
Paris bleiben. Inmitten von Chaos und Ruin suchen sie nach einer neuen Art der
malerischen Wahrnehmung in Opposition zu traditionellen Techniken und Themen.
Verband beide eine Liebesbeziehung? Immerhin war Manet verheiratet. Hat Morisot
versucht, die unkonventionelle Freundschaft zu retten, indem sie (später) Manets
Bruder Eugène heiratete?
Brillant recherchiert, mit scharfem Blick fürs Detail und literarischem Gefühl
für Charaktere und Situationen schreibt Sebastian Smee über Künstler, die sich
dem Neuen verpflichtet hatten: neuen politischen Kräfteverhältnissen; einer
neuen Art zu leben und zu fühlen; und einer neuen Art zu sehen - und zu malen.
Sebastian Smee - Paris im
Aufruhr - Liebe, Krieg und die Geburt des Impressionismus - Aus dem
amerikanischen Englisch von Stephan Gebauer. Insel Verlag - 495 Seiten - Mit
zahlreichen Abbildungen -
978-3-458-64528-3
Leseprobe & Infos
 Sargfabrikantengattin
sucht Bräutigam für ihre Tochter Sargfabrikantengattin
sucht Bräutigam für ihre Tochter
Babette
Bomberling ist jung und reizend. Indes, sie hat einen Makel: Die Familie verdankt ihren
Wohlstand der väterlichen Fabrik für Särge. Mutter Bomberling hat das Wohl der
Tochter im Blick und sucht einen Bräutigam von Adel oder akademischem Stand. Sie
schreckt nicht vor einer Schlankheitskur und einer Italienreise zurück, gerät
an eine zwielichtige Heiratsvermittlerin und muss doch feststellen, dass zu
guter Letzt alles anders kommt. Witzig und ironisch schildert die
deutsch-jüdische Schriftstellerin Alice Berend (1875–1938) eine illustre
Gesellschaft von reich gewordenen Kleinbürger:innen und verarmten Adligen,
Langzeitstudenten und aufstiegsbegierigen Parvenüs und hält ein vergangenes
Berlin lebendig, das erstaunlich aktuelle Züge trägt.
Alice Berend - Die Bräutigame der
Babette Bomberling - Hg. und m.
einem Nachwort v. Britta Jürgs - Aviva Verlag - 160 Seiten - Broschur -
978-3-932338-51-9 -
Leseprobe
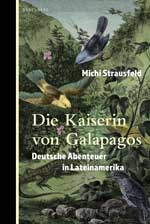 Lateinamerikanisches
Tableau Lateinamerikanisches
Tableau
Wenn man sie rein ließ, selten genug, durften auch Teutonen – Landsknechte,
Abenteurer, Jesuiten – früh jenes geheimnisvolle Reich in Übersee betreten, das
seit 1492 den Spaniern »gehörte«.
Erst nachdem die Staaten des südamerikanischen Kontinents unabhängig geworden
waren, kamen auch richtig viele Deutsche. Michi Strausfeld, die Lateinamerikas
Kultur wie kaum eine andere in Deutschland bekannt gemacht hat, berichtet, wie
sie kamen, warum und wer das war: Gauner, Exzentriker, Künstler, Kaufleute, die
Reichtümer witterten, eine Utopistin mit Kaiserkrone, Forscher, die sich um das
kümmerten, was ihnen Alexander von Humboldt übrig gelassen hatte. In Massen
kamen sie erst spät: Auswanderer, die daheim verhungert, Juden, die umgebracht
worden wären, auch ihre Nazi-Quälgeister, die hier nach 1945 ein Versteck
fanden. Und heute? Ein lateinamerikanisches Tableau, von 1492 bis zur Gegenwart,
in kräftig deutschen Farben.
Michi Strausfeld - Die Kaiserin von Galapagos
- Deutsche Abenteuer in Lateinamerika - Berenberg Verlag - 264 Seiten ˑ
Halbleinen ˑ 24,00 € - 978-3-911327-05-3
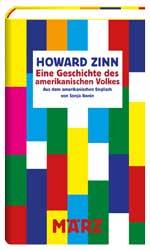 Revolutionärer
Klassiker Revolutionärer
Klassiker
Mit seinem Standardwerk ›Eine Geschichte des amerikanischen Volkes‹ hat Howard
Zinn die Geschichtsschreibung revolutioniert: Hier standen erstmals nicht die
großen politischen Figuren im Vordergrund, stattdessen versammelte er
Erfahrungen und Perspektiven der sogenannten »einfachen Bevölkerung«.
Erzählt wurden nicht mehr die Erfolge der Eroberer, sondern die Verluste und die
Gegenwehr der Besiegten und Unterjochten. Nicht im gehobenen Stil der
Herrschenden, sondern in der ungeschmückten Sprache der Beherrschten wird hier
Geschichte greifbar gemacht. Sklav:innen, Schwarze, Native Americans, Menschen
aus der Arbeiterklasse und Eingewanderte erhalten endlich das Wort. Mit diesem
Buch prägte Zinn den Begriff der »Geschichte von unten«. Seit der ersten Auflage
vor über 40 Jahren ist Zinns unkonventionelle Darstellung der amerikanischen
Geschichte von Kolumbus bis zur Ära Clinton weltweit knapp vier Millionen Mal
verkauft worden. Rasch entwickelte es sich vom Geheimtipp unter Studierenden zu
einem Standardwerk an amerikanischen Schulen und Universitäten. In der einen
Hälfte der USA steht das Buch heute auf dem Lehrplan, in der anderen Hälfte ist
es aus den Bibliotheken verbannt.
Howard Zinn - Eine Geschichte des amerikanischen Volkes
- Aus dem amerikanischen Englisch von Sonja Bonin und mit einem Vorwort von
Norbert Finzsch -
927 Seiten, gebunden mit Lesebändchen -
€
48,00 -
978-3-7550-0012-9
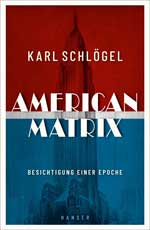 Was
macht Amerika aus? Was
macht Amerika aus?
Karl Schlögels besonderer Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts: die
großen Jahre der USA
Karl Schlögel hat als Historiker den Osten nach Europa zurückgebracht. Er hat
aber auch intensiv die USA bereist, wo ihn die Weite des Landes genauso
faszinierte wie in Russland. „American Matrix“ erzählt, wie Nordamerika von
Eisenbahn und Highway erschlossen wurde, Städte und Industrien aus dem Nichts
entstanden, Wolkenkratzer in den Himmel schossen – Errungenschaften einer
Gesellschaft, die sich frei von allen Traditionen fühlte. Das Versprechen des
American Way of Life veränderte die Welt genauso wie das sozialistische
Experiment. Karl Schlögels großes Buch beschreibt die USA aus einer einmaligen,
überraschenden Perspektive – und erzählt eine Geschichte des 20. Jahrhunderts,
wie sie noch nicht zu lesen war.
Karl Schlögel - American Matrix - Besichtigung
einer Epoche - Hanser Verlag- 832 Seiten - 45,00 € - 978-3-446-27839-4
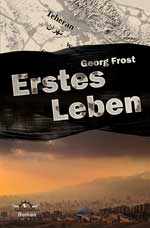 Abenteuer
im Hindukusch Abenteuer
im Hindukusch
August 2005: Der junge Journalist Tom reist mit seinem Filmteam in die iranische
Hauptstadt Teheran. Dort geht er mit der Englischstudentin Nahid eine
abenteuerliche Affäre ein, die ein grauenvolles Ende nimmt. Seine Reise als
Journalist ist vorbei, die als Spion hat gerade erst begonnen.
Es ist seine letzte Chance im Mediengeschäft: Tom soll mit seinem Filmteam im
August 2005 Bilder aus dem Iran liefern, die eine andere Seite des finsteren
Mullah-Regimes zeigen. Seine Aufnahmeleiterin Tina ist entschlossen, diese
Chance zu nutzen und einen Star aus Tom zu machen. In
Teheran engagieren sie zwei ortskundige Begleiter: Während Arash ein
ultrareligiöser Macho ist, lässt seine Schwester Nahid keine Gelegenheit aus,
sich dem Moralkorsett zu entziehen, das den Iranerinnen aufgezwungen wird. Die
beiden scheinen ideal für den Auftrag des Filmteams in der brodelnden
Millionenmetropole Teheran – bis Tom und Nahid eine abenteuerliche Affäre
eingehen, für die er bereit ist, sein bisheriges Leben aufzugeben.
Doch
das Regime hat eigene Pläne mit Tom. Es ist den Liebenden auf den Fersen und
bereitet ihrer Beziehung ein grauenvolles, vorläufiges Ende...
Der
erste Band der „Hindukusch“-Reihe erzählt die Vorgeschichte eines
deutsch-iranischen Doppelagenten, der nach dem Willen Teherans die in
Afghanistan eingesetzten ISAF-Truppen ins Chaos stürzen soll. Sie basiert auf Fachliteratur, journalistischen Reportagen und
Berichten von Soldaten, die im Rahmen der ISAF-Mission in Afghanistan eingesetzt
waren. Jeder Band enthält ein Verzeichnis der zugrundeliegenden Literatur. Die
in den Romanen geschilderten Personen und Ereignisse sind – sofern nicht Teil
der allgemeinen Zeitgeschichte – fiktiv, aber realistisch.
Georg
Frost - Erstes Leben -catware Verlag - 246
Seiten - 9,80 € - 9783941921740
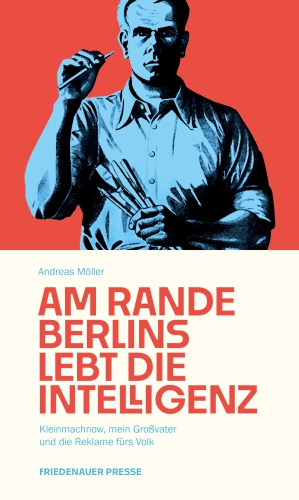 Geschichte
eines Überlebens Geschichte
eines Überlebens
Als sich der Werbegrafiker Andreas Nießen (1906–1996) in die bereits bei
UFA-Größen wie Heinz Rühmann und später führenden »Kulturschaffenden« wie
Christa Wolf beliebte Künstlersiedlung zurückzog, hatte er bewegte Jahre hinter
sich. Ab 1927 leitete er die Eigenwerbung des einflussreichen Berliner
Zeitungsverlags Mosse, erhielt 1937 Berufsverbot wegen der Ehe mit der Jüdin
Ella Mayer, die nach der Scheidung mit der gemeinsamen Tochter nach Amsterdam
floh und nur knapp der Deportation entging. Er überstand den Einsatz in der
Propagandakompanie an der Ostfront und zog 1954 mit seiner zweiten Familie an
den Rand Berlins, wo er sich neu erfand als Gestalter von Auftragswerbung für
volkseigene Betriebe und DDR-Ministerien. Als seine Arbeiten als
»unsozialistisch« verworfen wurden, geriet er in die Fänge der Staatssicherheit,
die ihn als Kopf eines oppositionellen Kreises von Künstlern und Intellektuellen
überwachte. Kleinmachnow als zeitentrücktem Ort kam dabei eine vergleichbare
Rolle für die sozialen Interaktionen im Künstlermilieu zu wie etwa dem Weißen
Hirsch in Dresden für das dortige Akademikermilieu, das sich vom Sozialismus
abkapselte – und durch seine Inselbildung zugleich gut für diesen sichtbar war.
Am Rande Berlins lebt die
Intelligenz
erzählt die Geschichte eines tief in das 20. Jahrhundert verwickelten
Künstlerdaseins. Es ist die Geschichte eines Überlebens und der politischen
Kompromisse in der Kultur- und Medienszene von der Weimarer Republik bis zur
Wiedervereinigung.
Andreas Möller - Am
Rande Berlins lebt die Intelligenz
-
Kleinmachnow, mein Großvater und die Reklame fürs Volk - 298
Seiten -
Preis: 25,00 € -
Leseprobe & Infos
 Das
Universum swingt Das
Universum swingt
Seit
über hundert Jahren krempelt die Quantentheorie die Welt um: Ohne sie gäbe es
weder die Kernspaltung noch die Halbleitertechnik. Sie lässt uns zuverlässige
Vorhersagen über physikalische Systeme treffen, weswegen wir entsprechende Dinge
erfinden können: Nahezu jedes Stück moderner Technologie vom
Magnetresonanztomographen bis zum Mobiltelefon wird von Quantenphysik gestützt,
was sie zu einem Grundpfeiler unserer Welt macht. Höchste Zeit also, dass auch
wir als Laien tiefer in dieses Wissenschaftsfeld vordringen und uns mit seinen
Grundprinzipien vertraut machen. Der Quantenphysiker Frank Verstraete entblättert für uns zusammen mit seiner Frau, der Autorin und
Künstlerin Céline Broeckaert, Schicht um Schicht die Quantenwelt.
Die Fortschritte in der Physik sind ein ständiges Pingpong zwischen Theorie und
Experiment, zwischen Denken und Überprüfen. Und letztlich sind es immer die
Experimente und nicht der Verstand oder das Bauchgefühl, die entscheiden, ob
eine neue Theorie notwendig ist. Ein Wissenschaftler schert sich nicht darum,
wer etwas zuerst entdeckt hat. Die Frage, die ihm den Schlaf raubt, lautet:
Welches wissenschaftliche Gesetz kann das erklären, was ich mit eigenen Augen
sehe? Und kann dieses Gesetz das Ergebnis zukünftiger Experimente vorhersagen?
Das ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methode und die einzig richtige
Weise, Wissenschaft zu betreiben. Letztendlich beruht auch unsere Intuition
«üblicherweise» nur auf unserer alltäglichen Erfahrung mit dem relativ Großen,
dem Sichtbaren sozusagen, sie ist jedoch unzuverlässig, sobald wir uns in die
Welt des mikroskopisch Kleinen begeben. Ein Atom, das, grob gesprochen, aus
einem Kern mit ihn umkreisenden Elektronen besteht, ist etwas völlig anderes als
eine Miniaturversion einer Sonne mit sie umrundenden Planeten. Was natürlich
nicht bedeutet, dass ein gutes Verständnis des Makroskopischen nicht hilfreich
sein kann, um mehr Einblick in das Mikroskopische zu gewinnen und umgekehrt.
Frank
Verstraete / Céline Broeckaert - Warum
niemand die Quantentheorie versteht, aber
jeder etwas darüber wissen sollte
-
C.H.Beck -
351 S., mit zahlreichen Grafiken und Zeichnungen -
28,00 € -
978-3-406-83622-0 -
Leseprobe
& Infos
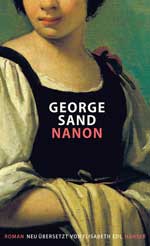 »Tausend
einfache und starke Dinge« »Tausend
einfache und starke Dinge«
George Sand ist Vielen nur wegen Ihrer Beziehung zu Frederic Chopin und ihrem
Buch Ein Sommer in Mallorca ein Begriff. Die Autorin steht bis heute zu Unrecht
im Schatten der großen Französischen Erzähler Balzac, Flaubert, Zola und Hugo.
Nun ist ihr Roman »Nanon« von Elisabeth Edl neu übersetzt worden.
Revolution ist Männersache? Nein! Denn George Sand, die unkonventionelle Frau unter den französischen Klassikern, erzählt es anders:
Nanon ist vierzehn, als 1789 die Revolution losbricht und alle Stände
niederreißt. Das Bauernmädchen, eine Leibeigene, wird Zeugin und Akteurin in
einem der größten Umbrüche der Geschichte. Als Mädchen noch Analphabetin,
schreibt Nanon im Alter ihr Leben auf: die packende Emanzipations- und
Bildungsgeschichte einer Frau in einem männlich geprägten Jahrhundert. Gustave
Flaubert war hingerissen »durch den Stil, durch tausend einfache und starke
Dinge, die eingewoben sind in den Stoff des Werks und die es ausmachen... Und
dann habe ich auf nichts mehr geachtet, ich wurde gepackt wie der
allergewöhnlichste Leser (dennoch glaube ich nicht, daß der Allergewöhnlichste
so sehr bewundern kann wie ich). Und Victor Hugo war sich sicher: »George Sand
hat in unserer Zeit einen einzigartigen Platz. Andere sind große Männer; sie ist
eine große Frau.« In ihrem erhellenden Nachwort setzt Elisabeth Edl das Leben
und Werk dieser außergewöhnlichen Frau ins ihr gemäße Licht.
George Sand - Nanon
- Roman -Aus dem Französischen von Elisabeth Edl -
Hanser Verlag - 496
Seiten - 38,00
€ -
978-3-446-28418-0 -
Leseprobe & Infos
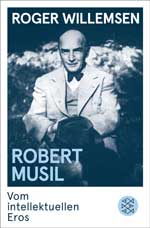 »Warum
es Literatur geben muss.« »Warum
es Literatur geben muss.«
Robert Musils Denken und Schreiben kennzeichnet eine Synthese von Genauigkeit
und Leidenschaft. Sein Werk enthält nicht allein das diagnostische Bild der
bestehenden Wirklichkeit, sondern auch die Bausteine einer Lebenslehre unter den
Maximen einer neuen Moral. Roger Willemsens Essay zeichnet das geistige Profil
dieses Jahrhundertautors und lässt sich zugleich als biographische Darstellung
lesen. Er beschreibt für Musil zentrale Begriffe wie Sinnlichkeit und
Erkenntnis, kritisches und utopisches Denken in ihrer Einheit und in ihren
radikalen Geltungsansprüchen. Und macht verständlich, warum Musil die Literatur
ganz unironisch »eine der wichtigsten Menschenangelegenheiten« nennen konnte.
Robert Musil war für Roger Willemsen eine intellektuelle Leitfigur. Musils
Anspruch, »Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt« zu leisten, gibt
Willemsen mit Emphase an uns weiter: »Musil ist ein gegenwärtiger Autor.« Der
Autor dieses wegweisenden Essays – Willemsens erstes Buch – ist es zehn Jahre
nach seinem Tod ebenso.
Roger
Willemsen - Robert Musil
- Vom
intellektuellen Eros - S.Fischer -
18,00 € -
978-3-596-70730-0 -
Leseprobe & Infos
Artikel online seit 15.11.25
|
|
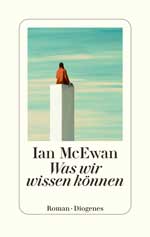 Kultur
verschwindet
Kultur
verschwindet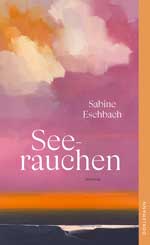


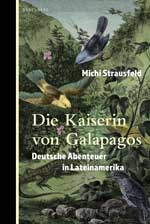 Lateinamerikanisches
Tableau
Lateinamerikanisches
Tableau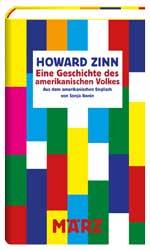 Revolutionärer
Klassiker
Revolutionärer
Klassiker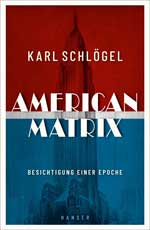 Was
macht Amerika aus?
Was
macht Amerika aus? 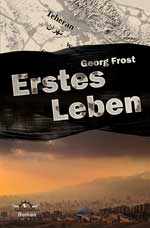
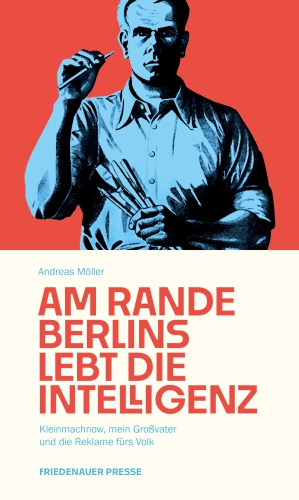

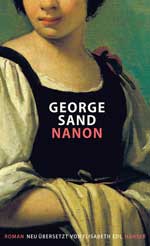
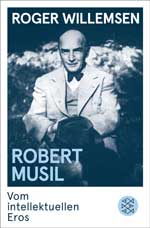 »W
»W